Frauen um Magnus Hirschfeld


Wer waren die Frauen, die Magnus Hirschfeld nahestanden und die ihn prägten? Mit welchen Frauen arbeitete er zusammen, und auf welche bezog er sich in seinen Schriften wie in seinen Vorträgen? Das sind nur drei Fragen, denen sich die Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft auf einer neuen Übersichtsseite ihres Internetauftritts widmet, zumindest ansatzweise. Denn in aller Kürze lassen sich diese Fragen kaum beantworten.
Zu dem angefügten Foto etwa können wir mit Sicherheit nur sagen, dass die zwei Frauen links neben Hirschfeld seine Schwestern Recha Tobias und Jenny Hauck sind. Zudem lässt sich die Liste der Fragen fortsetzen: Mit welchen Frauen kam Magnus Hirschfeld nicht überein und warum? Und was hielten eigentlich Frauen von Hirschfeld und seinen Ausführungen – zu seinen Lebzeiten wie nach seinem Tod? Im Guten wie im Schlechten.
Unbestritten gebührt es ja einer Frau, als eine der ersten nachdrücklich zum Nachruhm Hirschfelds beigetragen zu haben. Charlotte Wolffs Biografie über Hirschfeld als einem „Pioneer in Sexology“ von 1986 war selbst eine Pioniertat, die trotz einiger Kritik, die sie erfahren hat, einen soliden Grundstein für weitere Auseinandersetzungen mit dem Sexualforscher und Gründer des Berliner Instituts für Sexualwissenschaft legte.
In der folgenden tabellarischen Übersicht finden Sie biografische Einträge zu mehr oder weniger bekannten Frauen, die im Leben Magnus Hirschfelds und in der Auseinandersetzung mit ihm eine Rolle gespielt haben, von seiner Mutter und seinen drei Schwestern bis hin zu historischen Persönlichkeiten und den ersten Unterzeichnerinnen der Petition gegen den § 175 RStGB durch das von Hirschfeld mitgegründete Wissenschaftlich-humanitäre Komitees (WhK) sowie anderen namhaften Publizistinnen, Schriftstellerinnen, Künstlerinnen, Frauenrechtlerinnen und Aktivistinnen, die sich mit Themen beschäftigten, die vornehmlich Frauen, aber eben nicht nur sie angingen, so etwa dem Frauenwahlrecht, dem Schwangerschaftsabbruch, der Geburtenkontrolle, der Prostitution, der Zwangssterilisierung, dem Zugang zu Bildung und Arbeit und dem Recht auf ein selbstbestimmtes Leben wie der Emanzipation der Frau ganz allgemein.
Die folgenden Darstellungen wollen und können kein Resümee sein, sondern sollen als Auftakt und Anstoß verstanden werden. Denn so umfassend das Thema „Frauen um Magnus Hirschfeld“ auch ist, so gering ist in weiten Kreisen nach wie vor das Wissen um die Verhältnisse. Die Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft möchte mit ihrem Internetauftritt zu einer weiteren Beschäftigung mit Fragestellungen zum Thema anregen. Denn unbestritten ist, dass Frauen auch im Umfeld Magnus Hirschfelds keinen leichten Stand hatten. Ein Antrag auf Gründung einer Frauengruppe im WhK wurde noch 1907 abgelehnt.
Manches von dem durch uns Präsentierte ist sicher ausbaufähig, manches andere gewiss diskussionsbedürftig. In diesem Sinne versteht sich die Seite als ein „work in progress“. Für Korrekturen und Ergänzungen sind wir dankbar, und wir freuen uns auf jeglichen Hinweis, der dazu führt, das Thema „Frauen um Magnus Hirschfeld“ angemessener, gerechter und mit der ihm gebührenden Tiefe und Differenziertheit zu beleuchten. Unser Wunsch ist es, Wissen zu bündeln und die Diskussion nach vorn zu bringen, auf dass die einmal erarbeiteten Erkenntnisse nicht verloren gehen und in zukünftigen Darstellungen Berücksichtigung finden.
Albrecht, Berty (Publizistin, Widerstandskämpferin) geb. 15.2.1893 (Marseille, Frankreich) – gest. 31.5.1943 (Fresnes, Frankreich)
Zur Biografie


Berty Wild heiratete 1918 den niederländischen Bankier Frédéric Albrecht, mit dem sie in den Niederlanden und in England zusammenlebte und mit dem sie zwei Kinder bekam. In London lernte Berty Albrecht eine Reihe von britischen Feministinnen kennen, die sie ermunterten, sich für die Gleichberechtigung von Frau und Mann einzusetzen. Sie trennte sich von ihrem Ehemann und zog 1931 nach Paris, wo sie zwei Jahre später die feministische Zeitschrift Le Problème Sexuel gründete. Zu jener Zeit besaßen Frauen in Frankreich noch kein Wahlrecht, es gab so gut wie keine legalen Verhütungsmittel, und der Schwangerschaftsabbruch war streng verboten.
Berty Albrecht war Mitglied der Weltliga für Sexualreform (WLSR) und gab die Zeitschrift Le Problème Sexuel, die von 1933 bis 1935 mit insgesamt sechs Ausgaben erschien, zunächst zusammen mit Magnus Hirschfeld, dem britisch-australischen Arzt und Sexualreformer Norman Haire (1892–1952) und anderen heraus. Doch Hirschfelds Name wurde nur im ersten Heft genannt.
Weil es schon bald zu einem Konflikt zwischen Berty Albrecht und Hirschfeld kam, hat dieser sich später nicht mehr redaktionell oder als Autor in die Zeitschrift eingebracht. In dem Konflikt ging es um Anschuldigungen, die Norman Haire von Berty Albrecht gehört hatte. Haire verlangte daraufhin bei Hirschfeld um Aufklärung. In der Sache ging es auch um den Ruf der Weltliga für Sexualreform, die maßgeblich von Magnus Hirschfeld gegründet worden war und deren Präsident er war. Haire gehörte neben Hirschfeld und dem Schweizer Psychiater Auguste Forel (1848–1931) seit 1930 ebenfalls dem Präsidium der WLSR an.
Es scheint, Hirschfeld konnte den Konflikt mit Haire durch briefliche Einlassungen weitgehend beilegen, doch die Beziehung zwischen ihm und Berty Albrecht war zerrüttet. Für Hirschfeld war und blieb Albrecht „eine äußerst intrigante ehrgeizige Person“, die ihm viele Schwierigkeiten bereitet habe. In der letzten Ausgabe von Le Problème Sexuel (Juni 1935) wurde der Tod Magnus Hirschfelds nur kurz erwähnt. Zu der für das folgende Heft angekündigten Würdigung ist es nicht mehr gekommen.
Berty Albrecht stand in klarer Gegnerschaft zum Nationalsozialismus und nahm bereits 1933 deutschsprachige Flüchtlinge in ihrem Haus in Sainte-Maxime an der Côte d‘Azur, rund achtzig Kilometer südwestlich von Nizza, auf. 1940 war sie an der Gründung einer Organisation der nationalen Befreiung beteiligt, aus der die Widerstandgruppe „Combat“ („Kampf) hervorging. Hier wirkte Berty Albrecht unter anderem an der Herausgabe und Verbreitung illegaler Zeitschriften mit. Als bekannte Gegnerin und Aktivistin gegen den Nationalsozialismus wurde Berty Albrecht zunächst von der französischen Polizei, später auch von den deutschen Behörden überwacht.
Nachdem deutsche Truppen auch die Südzone Frankreichs besetzt hatten, wurde Berty Albrecht am 28. Mai 1943 von der Gestapo festgenommen und gefoltert. Am 31. Mai 1943 schied sie im Fort Montluc in der Gemeinde Fresnes unweit von Paris, das den deutschen Besatzern als Gefängnis diente, durch Selbstmord aus dem Leben. Ihr Leichnam wurde nach dem Zweiten Weltkrieg in der Gedenkstätte „Mémorial de la France combattante“ am Mont Valérien westlich von Paris beigesetzt.
Publikationen
Albrecht, Berty. Hrsg. (1933–1935): Le Problème Sexuel. Revue trimestrielle. Morale – Eugénique – Hygiène – Legislation. Paris: Imprimerie Centrale.
Weiterführende Literatur
Albrecht, Mireille (2001): Vivre au lieu d’exister. La vie exceptionnelle de Berty Albrecht, compagnon de la Libération. Monaco: Edition du Rocher.
Herzer, Manfred (2017): Magnus Hirschfeld und seine Zeit. Berlin: De Gruyter Oldenbourg, S. 323, 376-377.
List, Corinna von (2010): Frauen in der Résistance 1940–1944. „Der Kampf gegen die ‚Boches’ hat begonnen!” (Krieg in der Geschichte, 59). Paderborn u.a.: Schöningh.
Missika, Dominique (2005): Berty Albrecht. Paris: Perrin.
Andreas-Salomé, Lou (Schriftstellerin, Psychoanalytikerin) geb. 12.2.1861 (St. Petersburg, RUS) – gest. 5.2.1937 (Göttingen)
Zur Biografie


1880 zog Lou von Salomé in die Schweiz, wo sie als Gasthörerin Vorlesungen an der Universität in Zürich besuchte. Die Hochschule war damals eine der wenigen Hochschulen weltweit, die Frauen zum Studium zuließen. Eine ernsthafte Erkrankung zwang indes Lou von Salomé, ihr Studium zu unterbrechen. Um ihre angegriffene Lunge zu schonen, zog sie nach Rom, wo sie bald Kontakt zu der deutschen Schriftstellerin, Pazifisten und Frauenrechtlerin Malwida von Meysenburg (1816–1903) erhielt. In dem Kreis um von Meysenburg verkehrte auch der Philosoph Friedrich Nietzsche (1844–1900), der Lou von Salomé ähnlich wie ein gemeinsamer Freund einen Heiratsantrag machte. Doch auch diese beiden Verehrer wies Lou von Salomé ab. Nietzsche versuchte später, seine Erfahrungen mit Lou von Salomé in seinem Buch Also sprach Zarathustra (1883–85) zu bearbeiten.
Als Lou von Salomé 1886 ihren späteren Ehemann, den Göttinger Orientalisten Friedrich Carl Andreas (1846–1930), kennenlernte und er sie heiraten wollte, willigte sie nur unter der Bedingung ein, dass sie die Ehe niemals sexuell vollziehen müsse. Die Ehe zwischen Lou und Friedrich Carl Andreas war widersprüchlich, hielt aber bis zu seinem Tod über vierzig Jahre.
Nach ihrer Eheschließung kam Lou Andreas-Salomé unter anderem in Berührung mit dem Friedrichshagener Dichterkreis, in dem sie Gerhart Hauptmann (1862–1946) und Maximilian Harden (1861–1927) begegnete. In Artikeln und Rezensionen beschäftigte sie sich mit den Frauengestalten des norwegischen Dramatikers Henrik Ibsen und widmete sich der Frage: „Wie muss eine Ehe beschaffen sein, um auch der Selbstverwirklichung, besonders der Frauen, Raum zu lassen?“
Lou Andreas-Salomé lernte auch den Dichter Rainer Maria Rilke (1875–1926) kennen, mit dem sie zunächst eine leidenschaftliche Beziehung verband, die sich aber bald in eine enge Freundschaft wandelte. Lou Andreas-Salomé unterhielt später ein Verhältnis mit dem schwedischen Psychiater und Nervenarzt Poul Bjerre (1876–1964), der sie wiederum mit Sigmund Freud (1856–1939) zusammenführte. Freud war als Vaterfigur während ihrer letzten 25 Lebensjahre die entscheidende Bezugsperson Lou Andreas-Salomés.
Lou Andreas-Salomé besuchte in Wien Freuds Vorlesungen und nahm unter anderem an seinen „Mittwochssitzungen“ teil. Sigmund Freud selbst hielt viel von seiner Schülerin und riet ihr zum Beruf der Psychoanalytikerin. Sie veröffentlichte psychoanalytische Fachartikel, Essays und Bücher und eröffnete 1915 in Göttingen die erste psychoanalytische Praxis der Stadt, in der sie bis kurz vor ihrem Tod Patienten behandelte.
Lou Andreas-Salomé starb am 5. Februar 1937 nach langer schwerer Krankheit.
Nach der Einführung des allgemeinen Wahlrechts auch für Frauen in Deutschland gehörte Lou Andreas-Salomé neben den Schauspielerinnen Louise Dumont und Gertrud Eysoldt, der Grafikerin und Bildhauerin Käthe Kollwitz, der Schriftstellerin Grete Meisel-Heß und den beiden Frauenrechtlerinnen und Publizistinnen Adele Schreiber und Helene Stöcker zu den sieben erstunterzeichnenden Frauen der Petition des Wissenschaftlich-humanitären Komitees (WhK) gegen den § 175 RStGB, der mann-männliche Sexualkontakte mit Strafe belegte.
Schriften (Auswahl)
Andreas-Salomé, Lou (1892): Henrik Ibsen’s Frauen-Gestalten nach seinen sechs Familien-Dramen. Ein Puppenheim, Gespenster, die Wildente, Rosmersholm, die Frau vom Meere, Hedda Gabler. Berlin: Bloch.
Andreas-Salomé, Lou (1894): Friedrich Nietzsche in seinen Werken. Wien: Konegen.
Andreas-Salomé, Lou (1902): Im Zwischenland. Fünf Geschichten aus dem Seelenleben halbwüchsiger Mädchen. Stuttgart: J. G. Cotta.
Andreas-Salomé, Lou (1910): Die Erotik. Frankfurt/Main: Rütten & Loening.
Andreas-Salomé, Lou (1928): Rainer Maria Rilke. Leipzig: Insel.
Andreas-Salomé, Lou (1931): Mein Dank an Freud. Offener Brief an Professor Sigmund Freud zu seinem 75. Geburtstag. Wien: Internationaler Psychoanalytischer Verlag.
Andreas-Salomé, Lou (1951): Lebensrückblick. Grundriss einiger Lebenserinnerungen. Aus dem Nachlass herausgegeben von Ernst Pfeiffer. Zürich/Wiesbaden: Niehans/Insel.
Quellen
Hirschfeld, Magnus (1921): Aus der Bewegung, in: Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen (Jg. 20), S. 107-142, hier S. 114-115.
Asmus, Martha (Schriftstellerin) geb. 20.6.1844 (Pillkallen, heute Dobrowolsk, Russland) – gest. 28.1.1910 (Eberswalde)
Zur Biografie
Martha Asmus wurde am 20. Juni 1844 im ostpreußischen Pillkallen (heute Dobrowolsk, Russland) als Tochter eines Kreisarztes und dessen Frau geboren. Sie hatte vier Geschwister. Nach dem frühen Tod des Vaters zog die Mutter mit ihren Kindern nach Stolp in Pommern (heute Słupsk, Polen), wo Martha Asmus die Schule besuchte.
Martha Asmus ging später nach Halle an der Saale, wo einer ihrer Brüder lebte. Nach dessen Tod begann sie zu schreiben. Es entstanden Gedichte, Romane und Erzählungen, die in Zeitschriften wie dem Simplicissimus erschienen, wobei sich Martha Asmus auch des Pseudonyms „Martha Klodwig” bediente. Noch vor der Jahrtausendwende wandte sich Martha Asmus, die 1885 nach Berlin gezogen war, der Frauenbewegung zu und vertrat ab etwa 1899 die Ansicht von der psychischen Gleichheit der Geschlechter. Sie übersetzte Die Blumen des Bösen von Charles Baudelaire aus dem Französischen, freundete sich mit dem österreichischen Anthroposophen Rudolf Steiner (1861–1925) an und setzte sich kritisch mit der frauenfeindlichen Schrift Über den physiologischen Schwachsinn des Weibes des Neurologen und Psychiaters Paul Julius Möbius (1853–1907) auseinander.
Auch Magnus Hirschfelds Aufsatz „Die objektive Diagnose der Homosexualität“ im Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen von 1899 rief Martha Asmus’ Kritik hervor. Hirschfeld hatte in dem Aufsatz erstmals versucht, die Frage nach dem Geschlechtsunterschied zu erörtern. Unter Verweis auf Alltagserfahrungen hatte er fünf Gruppen von „Durchschnittstypen“ konstruiert, um den Unterschied zwischen Mann und Frau herauszuarbeiten.
Hirschfeld zufolge war das „Durchschnittsweib“ insgesamt „reproduktiver, anhaltender, treuer, praktischer, gemütvoller, reizbarer, kindlicher, äusserlicher, kleinlicher als der Mann.“ Es habe sich „vom Kinde nicht gar weit entfernt.“ Der Mann hingegen war für Hirschfeld „aktiver, produktiver, wechselnder, unternehmungslustiger, ehrgeiziger, härter, abstrakter als das Weib.“ Nach eigenen Worten wollte Hirschfeld mit diesen Zuschreibungen jedoch keine Unterlegenheit der Frauen den Männern gegenüber feststellen. Im Gegenteil, für ihn waren Frauen mit ihrer „kindlichen Art in bester Gesellschaft, in der Gesellschaft des Genies.“
Martha Asmus stellte Hirschfelds gesamtes Modell in Frage, attestierte ihm grobe Werturteile und schrieb: „In den genannten Verstandes- und Gemüts-Eigenschaften gibt es zwischen Mann und Weib keine graduellen Unterschiede.“ Ihre Kritik wurde 1900 durch den französischen Juristen und engen Mitarbeiter Hirschfelds im Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen Eugen Wilhelm („Numa Praetorius”) zurückgewiesen. Wilhelm sah die Einwände Asmus’ als nicht gerechtfertigt an, da Hirschfeld ja nur vom „Durchschnitt“ gesprochen habe, womit Ausnahmen von der Regel nicht ausgeschlossen seien.
Gleichwohl fragte Hirschfeld noch 1910, ob die Begabung von Frauen „für die Höchstleistungen der Kultur, die Schaffung auserlesener Meisterwerke in Technik, Kunst und Wissenschaft ausreichend“ sei. Er sah den vermeintlichen „Mangel an genialischen Leistungen und epochalen Schöpfungen“ bei Frauen nicht als gesellschaftlich, sondern als biologisch bedingt an. Zur Erklärung diente ihm nicht „die systematische Unterdrückung von Seiten der Männer“, sondern „die natürliche Beschaffenheit der Frauen an und für sich“.
Diese Äußerung dürfte Martha Asmus nicht mehr zur Kenntnis genommen haben. Sie starb am 28. Januar 1910 in der „Landesirrenanstalt” in Eberswalde.
Schriften (Auswahl)
Asmus, Martha (1899): Annette (Roman). Berlin: Hillger.
Asmus, Martha (1899): Homosexuell, in: Magazin für Literatur des In- und Auslandes (Jg. 68), Sp. 1145-1147.
Weiterführende Literatur
Herzer, Manfred (2017): Magnus Hirschfeld und seine Zeit. Berlin: De Gruyter Oldenbourg, S. 93-96.
Hirschfeld, Magnus (1899): Die objektive Diagnose der Homosexualität. In: Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen (Jg. 1), S. 4-35.
Hirschfeld, Magnus (1910): Die Transvestiten. Eine Untersuchung über den erotischen Verkleidungstrieb mit umfangreichem casuistischen und historischen Material. Berlin: Medicinischer Verlag Alfred Pulvermacher & Co, S. 277-278.
Wilhelm, Eugen (1900): Bibliographie der Homosexualität für das Jahr 1899, sowie Nachtrag zu der Bibliographie des ersten Jahrbuchs von Dr. jur. Numa Praetorius, in: Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen (Jg. 2), S. 345-445, hier S. 375.
Bækgaard, Ellen (Zahnärztin) geb. 14.11.1895 (Silkeborg, Dänemark) – gest. 1997 (Ort nicht belegt)
Zur Biografie


Wann genau und wie Ellen Bækgaard in Kontakt mit Magnus Hirschfeld gekommen ist, ist nicht belegt. Offenbar war sie in späteren Jahren vor allem eine Freundin von Hirschfelds Lebenspartner Karl Giese (1898–1938). Ellen Bækgaard erzählte Manfred Herzer in den 1980er Jahren, dass Giese einst als 15-Jähriger einen Vortrag Hirschfelds gehört und ihn danach aufgesucht habe. Giese sei von vielen als „Pflegesohn“ Hirschfelds betrachtet worden, und er selbst habe ihn auch „Papa” genannt. Bækgaard teilte aber mit, dass Giese in Wirklichkeit „die Frau des Hauses“ war. Damit Giese in den frühen 1930er Jahren in Wien das Abitur nachholen und sich dann an der Universität ausbilden lassen konnte, zahlten ihm Ellen Bækgaard, Magnus Hirschfeld und der australisch-britische Arzt und Sexualreformer Norman Haire (1892–1952) zu drei gleichen Teilen ein monatliches Stipendium.
Als Ellen Bækgaard Magnus Hirschfeld kennenlernte, erlebte sie Karl Giese als „das absolute Zwischenglied“ zwischen ihm und der Umwelt. Hirschfeld hatte Giese zum Archivleiter ausbilden lassen und ihn zum Sekretär des Instituts für Sexualwissenschaft und seiner selbst gemacht. An Hirschfeld als Institutsleiter erinnerte sich Bækgaard als an einen „eitl[en] Mann“, der sich seiner Bedeutung bewusst gewesen sei. Wenn er auswärts war, habe er immer in den besten Hotels gewohnt und es angemessen gefunden, dass man ihm Prozente gewährte. Auch habe er große Feste veranstaltet, „bei denen nahezu keine Frauen anwesend waren.“
Ellen Bækgaard hatte noch 1985 gut die Räumlichkeiten und einzelne Begebenheiten vor Augen, die sie vor 1933 im Institut für Sexualwissenschaft erlebt hatte. Auch wenn sie behauptete, es sei immer schwierig gewesen, zu Magnus Hirschfeld selbst zu kommen, wusste sie gleichzeitig von drei Situationen zu berichten, in denen Besucher sofort zu Hirschfeld vorgelassen wurden.
Da war zum einen Karl Giese, der Hirschfeld (wohl um 1914) noch als Jugendlicher aufsuchte. Zum anderen erinnerte sich Ellen Bækgaard an ein Ereignis während des vierten Kongresses der Weltliga für Sexualreform (WLSR), der mit etwa 2.000 Aktiven vom 16. bis zum 23. September 1930 in Wien stattfand. „Es war eine geschlossene Gesellschaft in einem reservierten Lokal, aber am Abend kam eine Dame herein, die wir nie vorher gesehen hatten. Sie wurde sofort zu Magnus Hirschfeld geführt, der ihr viel Freundlichkeit und Interesse zeigte. Sie war, was man damals eine ‚noble‘ Dame nannte, sowohl im Aussehen wie im Benehmen, und wurde von allen mit ‚gnädige Frau‘ angesprochen.“ Erst nachdem „die Dame” gegangen war, erfuhr Bækgaard Näheres über sie: Sie war „ein hochstehender Ministerialbeamter! Er war verheiratet mit einer sehr verständnisvollen Frau und sie hatten zwei kleine Kinder.“ Einen Namen nannte Ellen Bækgaard leider nicht.
Ein anderes Mal erlebte sie etwas Ähnliches, als sie zu Besuch bei Karl Giese in Berlin war. Die „Hausdame“ im Institut für Sexualwissenschaft, Helene Helling, meldete – vermutlich über das Haustelefon – „daß eine Dame auf dem Weg sei, um zu einer Verabredung zu Magnus Hirschfeld zu kommen.“ Wiederum ohne einen Namen zu nennen, führte Bækgaard aus, die Besucherin habe „eine hübsche und sehr dunkle Altstimme“ gehabt, gleichwohl sei sie „für eine Dame eine seltsame Erscheinung“ gewesen: „Ich vergesse sie niemals. Es war in der Zeit um 1930 und da sah eine Dame so nicht aus. Sie war sehr groß und kräftig […] – das war an sich nicht merkwürdig – aber sie war ‚aufgedonnert‘ und am hellichten Tag stark geschminkt. In den Ohren hatte sie große prunkvolle Ohrringe, und sie trug blitzenden Schmuck und sehr farbige, aber elegante Kleidung. Sie sah unglaublich teuer aus. Etwas Ähnliches – aber nur ein[en] Abglanz von ihr – habe ich in Monte Carlo gesehen.“ Karl Giese erzählte Ellen Bækgaard später, dass die Dame „Rittmeister war! Und im aktiven Dienst!! Es war ja strafbar damals, Transvestit zu sein. So ein Mut!“
Ellen Lebrecht Bækgaard starb 1997 im Alter von 102 Jahren.
Weiterführende Literatur
Bækgaard, Ellen (1985): Das Sexualwissenschaftliche Institut in Berlin. In: Mitteilungen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft, Nr. 5, S. 32-35.
Hertoft, Preben und Teit Ritzau (1984): Paradiset er ikke til salg. Trangen til at være begge køn. Kopenhagen: Lindhardt og Ringhof.
Film
Ritzau, Teit (1985): Paradiset er ikke til salg (62 Min.),auf der Streamingseite des Dänischen Filminstituts hier.
Berber, Anita (Tänzerin) geb. 10.6.1899 (Leipzig) – gest. 10.11.1928 (Berlin)
Zur Biografie
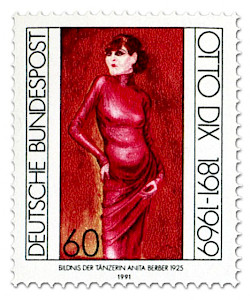

Um 1914 zog Anita Berger nach Berlin, wo sie Unterricht bei der österreichischen Theaterschauspielerin Maria Moissi (1874–1943) nahm. Zeitgleich ließ sie sich bei der deutschen impressionistischen Ausdruckstänzerin Rita Sacchetto (1880–1959) ausbilden. 1916 stand sie zum ersten Mal auf einer Bühne und tanzte vor Publikum, es folgten Auftritte in Städten wie Hannover, Leipzig, Hamburg und Frankfurt am Main, Gastspiele brachten sie auch nach Österreich und in die Schweiz.
1918 wurde Anita Berber von dem österreichischen Produzenten, Drehbuchautor und Filmregisseur Richard Oswald (1880–1963) für den Film entdeckt. Sie zeigte sich 1919 unter anderem an der Seite Magnus Hirschfelds und Conrad Veidts (1893–1943) in dem Aufklärungsfilm „Anders als die Andern“ und in dem Sittenfilm „Die Prostitution“. Insgesamt war sie in etwa fünfundzwanzig Filmen zu sehen. Bilder von ihr wurden bald sogar in US-amerikanischen Medien wie der Zeitschrift Vanity Fair gedruckt.
Anita Berber trat in dem Berliner Kabarett „Schall und Rauch“ und in Hamburg auf St. Pauli auf, wo sie die erste Nackttänzerin ihrer Zeit war. Entblößte Brüste waren bis dahin von der deutschen Polizei nur in „Standbildern“ und nicht in bewegten Szenen geduldet worden.
1922 ließ sich Anita Berber nach nur drei Jahren Ehe von ihrem ersten Mann scheiden und zog zu ihrer lesbischen Freundin Susi Wanowski (Susu Wannowsky u.ä.), die später die Frauenbar „La Garçonne“ in der Kalkreuthstraße 11 in Berlin-Schöneberg betrieb.
Die Erfolge, die Anita Berber insbesondere an der Seite ihres künstlerischen homosexuellen Partners Sebastian Droste (eigentlich Willy Knobloch, 1898–1927) feiern konnte – unter ihnen das Programm „Tänze des Lasters, des Grauens und der Ekstase“ – konnten nicht verhindern, dass Berber ebenso wie Droste bald drogensüchtig wurde. Insbesondere Droste kam wegen Eigentumsdelikten auch mehrmals mit dem Gesetz in Konflikt und musste Haftstrafen antreten.
Am 10. September 1924 heiratete Anita Berber den amerikanischen Tänzer Henri Châtin-Hofmann (1900–1961), den sie im Jahr zuvor in Berlin kennengelernt hatte. Sie stand in Kontakt mit Klaus Mann (1906–1949) und Otto Dix (1891–1969), fortwährende Drogen- und Alkoholexzesse, Tumulte, Skandale und Beschwerden über ihre „unsittlichen“ Darbietungen führten aber dazu, dass ihr Stern langsam sank.
Im Sommer 1928 brach Anita Berber während eines Auftritts in Damaskus (Syrien) vor ihrem Publikum zusammen. Die herbeigerufenen Ärzte diagnostizierten eine Tuberkulose-Erkrankung, die keine Aussichten auf Heilung mehr versprach. Anita Berber starb am 10. November 1928 im Bethanien-Krankenhaus in Berlin-Kreuzberg. Sie war 29 Jahre alt geworden. Magnus Hirschfeld schrieb in Die Weltreise eines Sexualforschers (1933): „Wie überall zeigen auch auf Bali viele Tänzer einen auffallend weiblichen, viele Tänzerinnen einen jungenhaften Einschlag. Androgynen Tänzerpaaren, wie ‚Anita Berber und Henry‘ begegnete ich in der ganzen Welt wieder.“
Weiterführende Literatur
Berber, Anita und Sebastian Droste (1922): Die Tänze des Lasters, des Grauens und der Ekstase. Wien: Gloriette-Verlag.
Fischer, Lothar (1996): Anita Berber 1918–1928 in Berlin. Tanz zwischen Rausch und Tod (Edition Jule Hammer). Berlin: Haude & Spener.
Fischer, Lothar (2006): Anita Berber. Göttin der Nacht. Collagen eines kurzen Lebens. Berlin: edition ebersbach.
Hirschfeld, Magnus (1933): Die Weltreise eines Sexualforschers. Brugg: Bözberg-Verlag, S. 152.
Scheub, Ute (2000): Verrückt nach Leben. Berliner Szenen in den zwanziger Jahren. Reinbek: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
Wunderlich, Dieter (2009): AußerOrdentliche Frauen. 18 Porträts. München: Piper-Verlag, S. 106-115.
Film
Praunheim, Rosa von (1987): Anita – Tänze des Lasters / Anita – Dances of Vice [mit Lotti Huber (1912–1998) u.a.]. Rosa von Praunheim (Regie). DVD: Pillarbox.
Brugman, Til (Schriftstellerin) geb. 16.9.1888 (Amsterdam, Niederlande) – gest. 24.7.1958 (Gouda, Niederlande)
Zur Biografie


Til Brugmann liess sich in Amsterdam zur Fremdsprachenkorrespondentin ausbilden und zog 1917 nach Den Haag, wo sie mit ihrer Freundin, einer Sängerin, zusammenlebte. Sie verdiente sich in dieser Zeit ihren Lebensunterhalt als Handelskorrespondentin und später als selbständige Fremdsprachenlehrerin. Nachdem sie mit renommierten Stijl-Künstlern und Architekten in Kontakt gekommen war, begann sie, Lautgedichte zu schreiben: rhythmische Klangkonstruktionen, die ohne erkennbaren Bezug zur Realität standen.
1926 lernte Til Brugman die deutsche Dadaistin Hannah Höch (1889–1978) kennen, mit der sie über neun Jahre lang zusammenlebte. Unter dem Einfluss Höchs begann Brugman, Grotesken zu schreiben, die sich durch die Vermengung von Ernstem mit Komischem, Realistischem mit Fantastischem sowie Verzerrungen und Übertreibungen auszeichneten. Sie schrieb diese Grotesken zunächst auf Niederländisch und ab 1929, nachdem sie mit Höch nach Berlin gezogen war, auch auf Deutsch.
Til Brugman schrieb Hunderte von Groteksen, fand für ihre Arbeiten aber kaum Verleger. Am bekanntesten blieb ihre Sammlung Scheingehacktes (1936), die Zeichnungen von Hannah Höch enthielt. Noch 1936 trennten sich Brugman und Höch, doch blieb Brugman noch drei Jahre in Berlin wohnen, bevor sie zurück in die Niederlande zog. Zusammen mit ihrer neuen Freundin Hans Mertineit-Schnabel wohnte sie im Amsterdamer Stadtteil Rivierenbuurt, wo sie auch mit der Widerstandsbewegung gegen die deutsche Besatzung der Niederlande zusammenarbeitete. Um 1945 schrieb Brugman an einem Roman, der 1953 unter dem Titel „Spanningen“ (dt. „Spannungen”) veröffentlicht wurde. In dem Buch bekannte sie, dass sich ihre Hoffnungen auf eine gerechte Nachkriegsgesellschaft zerschlagen hätten. Die Menschen schienen nicht aus dem erlittenen Elend und dem vorübergehend erfahrenen Gefühl der Zusammengehörigkeit gelernt zu haben.
Brugman, die seit 1937 unter erheblichen gesundheitlichen Beschwerden litt, fand im Großen und Ganzen aber keinen Anschluss an die neue Schriftstellergeneration nach dem Zweiten Weltkrieg. Zwar wurde sie 1952 mit dem Novellenprijs der Stadt Amsterdam und dem Marianne Philipsprijs ausgezeichnet. Doch als sie am 24. Juli 1958 im niederländischen Gouda starb, geriet ihr Werk schnell in Vergessenheit.
Erst ab den 1980er Jahren erwachte das Interesse an Til Brugman wieder. Die Aufmerksam galt nun aber vor allem ihrem Leben als lesbische Frau im Kreis der Avantgarde. Bekannt ist, dass Til Brugman im August 1931 das Institut für Sexualwissenschaft besuchte, um sich das „pathologische Museum“ eines gewissen „Professor Hirschmann oder so“ anzuschauen, wie sie ihrer Freundin Hannah Höch mitteilte. Wenn ihr auch der Name Magnus Hirschfelds nicht in Erinnerung blieb, machte die im Institut für Sexualwissenschaft ausgestellte Sammlung von Exponaten Eindruck auf sie. Til Brugman verfasste nach dem Besuch eine vom Dada-Stil beeinflusste Groteske unter dem Titel „Das Warenhaus der Liebe“ („Liefdeswarenhuis“). Hier beschrieb sie, wie die Besucher und Besucherinnen des Museums in den unterschiedlichsten Abteilungen für wunderliche Fetische und Obsessionen fündig und glückselig werden. Die Groteske schließt mit einer bedrohlichen Vision, die das Ende des Instituts knapp zwei Jahre später vorwegzunehmen scheint.
Schriften (Auswahl)
Brugman, Til (1935): Scheingehacktes. Zeichnungen von Hannah Höch (Die neue Reihe, 22/23). Berlin: Verlag Die Rabenpresse.
Brugman, Til (1953): Spanningen. Amsterdam: Contact.
Brugman, Til (1988): Liefdeswarenhuis. In: Lust & Gratie (Jg. 5), Nr. 19, S. 58-65.
Brugman, Til (1995): Das vertippte Zebra. Lyrik und Prosa. Hgg. von Marion Brandt. Berlin: Hoho-Verlag.
Weiterführende Literatur
Everard, Myriam (1988): Til Brugman (1888–1958), in: Lust & Gratie (Jg. 5), Nr. 19, S. 10-17 (online hier).
Everard, Myriam (1991): „Man lebt nur einmal in Parchamatac”. Die groteske Welt von Til Brugman, Lebensgefährtin von Hannah Höch. In: Dech, Julia und Elen Maurer (Hrsg.): Da-da-zwischen-Reden zu Hannah Höch. Berlin: Orlanda, S. 82-97.
Hermans, Doris (o.J.): Til Brugman, auf: Fembio Frauen.Biographieforschung.
Slob, Marleen (1994): „De mensen willen niet rijpen, vandaar”. Leven en werk van Til Brugman. Amsterdam: Feministische Uitgeverij Vita.
Slob, Marleen (2013): Brugman, Mathilda Maria Petronella (1888–1958), in Biografisch Woordenboek van Nederland.
Cauer, Minna (Pädagogin, Frauenrechtlerin) geb. 1.11.1841 (Freyenstein, Prignitz) – gest. 3.8.1922 (Berlin)
Zur Biografie


1862 heiratete Minna Schelle zum ersten Mal. Sie wurde Mutter eines Sohnes, der jedoch schon im Alter von zwei Jahren an Diphterie verstarb. Im Jahr darauf starb auch ihr Ehemann. Früh verwitwet wandte sie sich nun frauengeschichtlichen Studien zu und entschied sich zu einer pädagogischen Ausbildung, legte das diesbezügliche Examen 1867 ab und arbeitete ab 1868 als Lehrerin zunächst in Paris. 1869 wechselte sie an eine Töchterschule in Hamm (Westfalen), und hier lernte sie den Gymnasialdirektor Eduard Cauer kennen, den sie wenig später heiratete. Eduard Cauer war verwitwet und Vater von fünf Kindern im Schulalter.
1871 zog Minna Cauer mit ihrer Familie nach Danzig (Gdańsk, Polen) und 1876 von dort nach Berlin. Nachdem ihr zweiter Ehemann 1881 verstorben war, widmete sich Minna Cauer ganz der Frauenbewegung. Sie wurde Mitbegründerin des Vereins Frauenwohl (1888), der unter anderem Bildungskurse und eine Stellenvermittlung für Frauen anbot, und leitete diesen bis 1919. Sie engagierte sich vehement für das Frauenstimmrecht, die finanzielle und soziale Unterstützung lediger Mütter und die freie Berufswahl für Frauen. Außerdem betätigte sie sich aktiv in der Deutschen Friedensgesellschaft, die von Bertha von Suttner (1843–1914) gegründet worden war.
Nach Unstimmigkeiten mit anderen führenden Aktivistinnen der deutschsprachigen Frauenbewegung trennte sich Minna Cauer um 1900 von der „gemäßigten“ Mehrheit der in der Bewegung Engagierten und sammelte die „radikalen“ Kräfte in dem neu gegründeten Verband Fortschrittlicher Frauenvereine. Als Lebenswerk Minna Cauers gilt die Vereinszeitschrift Die Frauenbewegung, die sie 1895 gegründet hatte und bis 1919 herausgab. Sie war das Sprachrohr des „linken“ Flügels der deutschsprachigen Frauenbewegung und zählte etwa Anita Augspurg, Hedwig Dohm, Lida Gustava Heymann (1868–1943) und Anna Pappritz zu ihren Mitarbeiterinnen. Persönlich befreundet war Minna Cauer unter anderem mit dem Industriellen und deutschen Außenminister Walther Rathenau (1867–1922), der im Sommer 1922 von Rechtsextremisten ermordet wurde.
Minna Cauer starb wenig später, am 3. August 1922, in Berlin und wurde auf dem Alten St.-Matthäus-Kirchhof in Berlin-Schöneberg beigesetzt.
Wie eng sich die Beziehung und die Zusammenarbeit zwischen Minna Cauer und dem fast 30 Jahre jüngeren Magnus Hirschfeld gestaltete, ist – ähnlich wie im Falle Hedwig Dohms – nicht belegt. In der Literatur werden Cauer und Dohm immer wieder als „Freundinnen“ Hirschfelds bezeichnet, doch ist nicht ganz klar, was in ihrem Fall unter dem Begriff Freundschaft zu verstehen ist. Auch ist nicht bekannt, wann und wie die drei sich kennengelernt haben. Belegt ist, dass Magnus Hirschfeld 1915 zusammen mit Minna Cauer und Helene Stöcker Mitglied im pazifistischen Bund „Neues Vaterland“ wurde, der zu Beginn des Ersten Weltkriegs gegründet worden war. Vermutlich war aber Hirschfeld nur passives Mitglied. Zudem wurde der Bund „Neues Vaterland“ bereits im Februar 1916 verboten.
In seinen Schriften erwähnte Magnus Hirschfeld Minna Cauer eher selten. Er nannte sie als Teilnehmerin einer Diskussion im Anschluss an einen Vortrag im Wissenschaftlich-humanitären Komitee (WhK), „würdigte“ sie in einer fast 30 Namen umfassenden Aufzählung als zentrale Vorkämpferin der Frauenemanzipation, der er „edle Kühnheit“ bescheinigte, sprach einmal kurz die Biografie an, die Else Lüders (1872–1948) drei Jahre nach Cauers Tod vorgelegt hatte, und brachte Cauers Foto in seinem Bildband der Geschlechtskunde (1930), wobei er aber nicht einmal den Namen der Fotografin (Margarete Schurgast) und das Entstehungsjahr des Fotos (1907) erwähnte und sogar ein falsches Sterbejahr angab. Vermutlich gehörte Minna Cauer eher zu den engeren Bezugspersonen Franziska Manns, der Schwester Magnus Hirschfelds.
Schriften (Auswahl)
Cauer, Minna (1898): Die Frau im 19. Jahrhundert (Am Ende des Jahrhunderts, 2). Berlin: Cronbach.
Cauer, Minna (1907): Dress Reform in Germany, in: The Independent. A Weekly Magazine, 24.10.1907 (Jg. 63, Ausg. 3073), S. 993-997. (Das Porträtfoto Margarete Schurgasts von Minna Cauer wurde hier offenbar erstmals abgedruckt, S. 995, vgl. online hier.)
Cauer, Minna (1913): 25 Jahren Verein Frauenwohl Groß-Berlin. Berlin: Loewenthal, online einsehbar hier.
Würdigungen
2006 wurde eine Straße in Berlin-Moabit nach Minna Cauer benannt. Ebenso gibt es heute Minna-Cauer-Straßen in Endingen (Kaiserstuhl), Freyenstein und Bremen. Das Grab Minna Cauers auf dem Alten St.-Matthäus-Kirchhof in Berlin-Schöneberg ist seit 1952 Ehrengrab der Stadt Berlin.
Weiterführende Literatur
Briatte, Anne-Laure (2020): Bevormundete Staatsbürgerinnen. Die „radikale“ Frauenbewegung im Deutschen Kaiserreich (Geschichte und Geschlechter, 72). Frankfurt/Main: Campus, S. 53-57 [Originaltitel: Citoyennes sous tutelle: le mouvement féministe «radical» dans l’Allemagne wilhelmienne, 2013].
Geyken, Frauke (2019): Minna Cauer, geb. Schelle (1841–1922), auf Frankfurter Frauenzimmer.
Hirschfeld, Magnus (1930): Geschlechtskunde. Dritter Band: Folgen und Folgerungen. Stuttgart: Julius Püttmann, S. 268.
Jank, Dagmar (1991): „Vollendet, was wir begonnen!“ Anmerkungen zu Leben und Werk der Frauenrechtlerin Minna Cauer (1841–1922) (Ausstellungsführer der Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin, 23). Berlin: Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin.
Jank, Dagmar (2022): „Eine Kämpferin für Frauenrecht und Demokratie“. Die Erinnerungsarbeit für die Frauenrechtlerin und Publizistin Minna Cauer (1841–1922) in der Weimarer Republik, in: Berlin in Geschichte und Gegenwart. Jahrbuch des Landesarchivs Berlin, S. 81-100.
Löchel, Rolf (o.J.): Minna Cauer, auf Fembio Frauen.Biographieforschung.
Lüders, Else (1925): Minna Cauer. Leben und Werk: Gotha: Perthes.
Wolff, Kerstin (2018): Das Zeitalter der Vorreiterinnen, Entdeckerinnen und Visionärinnen, in: Linnemann, Dorothee (Hrsg.): Damenwahl! 100 Jahre Frauenwahlrecht (Schriften des Historischen Museums Frankfurt, 36). Frankfurt/Main: Societäts Verlag, S. 40-51.
Charlaque, Charlotte (Schauspielerin) geb. 14.9.1892 (Berlin) – gest. 6.2.1963 (New York, USA)
Zur Biografie


Charlotte Charlaque wuchs zunächst in Berlin auf, wo ihr Vater eine Manufakturwarenhandlung betrieb. Er wanderte 1901 in die USA aus, und seine Frau und seine beiden Kinder folgten ihm im Jahr darauf. Die Familie ließ sich in San Francisco nieder, wo die Scharlachs Zeugen des verheerenden Erdbebens geworden sein dürften, das die Stadt 1906 heimsuchte.
Nachdem die Eltern sich hatten scheiden lassen, zogen die Mutter und ihr ältester Sohn zurück nach Deutschland. Charlotte Charlaque ging zunächst nach Chicago und von dort nach New York, wo sie sich zum „Violinisten“ ausbilden ließ. Im Sommer 1922 kehrte dann aber auch sie nach Deutschland zurück, laut ihrem US-amerikanischen Pass, zu Studienzwecken.
Wohl in ihrer frühen Berliner Zeit trat Charlotte Charlaque als Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin auf, später arbeitete sie auch als Sprachlehrerin und Übersetzerin sowie als Rezeptionistin im Institut für Sexualwissenschaft Magnus Hirschfelds. Ihre Aufgabe bestand hier unter anderem darin, „transvestitische“ Patienten und Patientinnen bei der Auswahl ihrer Kleider zu beraten. 1929 begleitete Charlotte Charlaque Magnus Hirschfeld und dessen Lebenspartner Karl Giese (1898–1938) auch zum dritten internationalen Kongress der Weltliga für Sexualreform (WLSR) in London.
Um diese Zeit – das heißt in den Jahren von 1929 bis 1931 – unterzog sich Charlotte Charlaque in Berlin geschlechtsangleichenden Operationen, die zum Teil von dem britischen Essayisten und Sexologen Havelock Ellis (1859–1939) und dem dänischen Arzt Jonathan Høegh von Leunbach (1884–1955) finanziert wurden. Charlotte Charlaque gehörte damit neben der Küchenhilfe Dora Richter und der Malerin Toni Ebel, mit denen sie befreundet war, zu den ersten drei namentlich bekannten „Fällen“ geschlechtsangleichender Operation weltweit. 1933 traten alle drei Frauen kurz in dem österreichischen Film Mysterium des Geschlechts von Lothar Golte auf. Ungefähr zur gleichen Zeit gaben Charlotte Charlaque und Toni Ebel dem schwedischen Journalisten Ragnar Ahlstedt (1901–1982) ein Interview, in dem sie Einblicke in ihren Lebensweg und ihre damalige Lebenssituation gewährten.
Insbesondere mit Toni Ebel verband Charlotte Charlaque eine innige Freundschaft, und schon um 1932 wohnten die zwei Frauen zusammen. Da Charlotte Charlaque Jüdin war, Toni Ebel Anfang der 1930er Jahre zum Judentum konvertierte und beide Frauen entschiedene Gegnerinnen des Nationalsozialismus waren, flüchteten sie im Frühjahr 1934 gemeinsam in die Tschechoslowakei, wo sie sich zunächst in Karlsbad (Karlovy Vary) und später in Brünn (Brno) bzw. Prag niederließen. Während Ebel Bilder für Kurgäste und andere Auftraggeber*innen malte, erteilte Charlotte Charlaque Englisch- und Französischunterricht, wohl auch für Juden und Jüdinnen, die sich auf der Flucht vor der Verfolgung durch die deutschen Nationalsozialisten befanden.
Schon einige Monate vor dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht in die Tschechoslowakei und der Errichtung des „Protektorats Böhmen und Mähren“ spitzten sich die Ereignisse für Charlotte Charlaque und Toni Ebel zu. Bei ihnen wurden Haussuchungen durchgeführt, und insbesondere Toni Ebel galt bald als „ungebetene Ausländerin“ in der Tschechoslowakei. Der Umzug von Brünn nach Prag bedeutete nur vorübergehend eine Erleichterung für die beiden Freundinnen.
Charlotte Charlaque wurde am 19. März 1942 von der Prager Fremdenpolizei verhaftet, nachdem die Behörden in Erfahrung gebracht hatten, dass sie Jüdin war. Ursprünglich sollte sie in Theresienstadt interniert werden, eine entsprechende Kennkarte war schon für sie angelegt. Doch gelang es Toni Ebel auf bisher nicht ganz geklärten Wegen, den Schweizer Konsul in Prag davon zu überzeugen, dass ihre Freundin amerikanische Staatsbürgerin sei. Sie habe nur deshalb keine entsprechenden gültigen Ausweisepapiere mehr, weil sie sie dem amerikanischen Vizekonsul in Wien übergeben habe, um einen neuen Pass zu bekommen. Was Toni Ebel dabei verschwieg, war, dass der Vizekonsul in Wien sich geweigert hatte, den Pass Charlotte Charlaques auf einen weiblichen Namen auszustellen.
Charlotte Charlaque wurde daraufhin in das Internierungslager Liebenau überführt, das 1940 in einer ehemaligen Heilanstalt am Bodensee eingerichtet worden war. Von hier aus wurde sie zusammen mit anderen nicht-deutschen Frauen und Kindern, die für den Austausch gegen Amerikanerinnen und Britinnen deutscher Herkunft vorgesehen waren, in die USA verschickt. Ihre Freundin Toni Ebel blieb allein in Prag zurück.
Charlotte Charlaque erreichte am 2. Juli 1942 New York, wo sie bis zu ihrem Lebensende wohnen blieb. Sie war über weite Strecken von der Armenfürsorge abhängig und litt unter einer angegriffenen Gesundheit. Gleichwohl gelang es ihr, sich als Off-Broadway-Schauspielerin einen gewissen Namen zu machen und auf der Bühne Erfolge zu feiern. Sie nannte sich unter Anspielung auf ihren alten Geburtsnamen jetzt gern Carlotta Baronin von Curtius. Privat stand sie in Kontakt mit dem deutsch-amerikanischen Arzt und Endokrinologen Harry Benjamin (1885–1986), der „Crossdresserin“ Louise Lawrence (1912–1976) und Christine Jorgensen (1926–1989), der im Zuge ihrer Geschlechtsangleichung 1952 große mediale Aufmerksamkeit zufiel.
Charlotte Charlaque starb am 6. Februar 1963 völlig verarmt in New York. Bei einer Trauerfeier wenige Tage später wurde sie von William Glenesk (1926–2014), der als innovativer Geistlicher und später auch als Fürsprecher für Menschen aus dem LSBTIQ*-Spektrum bekannt war, in einer Gedenkrede gewürdigt.
Weiterführende Literatur
Ahlstedt, Ragnar (2021): Männer, die zu Frauen wurden. Zwei Fälle von Geschlechtsumwandlung auf operativem Weg. Eine Studie über das Wesen des Transvestitismus. In: Mitteilungen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft, Nr. 67, S. 33-40.
Curtius, Carlotta Baronin von (1955): Reflections on the Christine Jorgenson Case, in: One. The Homosexual Magazine (Jg. 3), Nr. 3, S. 27-28.
Junghanns, Inga (1932): En Operation. Den skønne Lola Montez er blevet Kvinde efter at have levet hele sit Liv som Mand, in: Social-Demokraten for Randers og Omegn, 7.6.1932, S. 5.
Keil, Frank (2022): Namensakte Charlotte Charlaque. Operieren, therapieren, administrieren: Vom Umgang mit Transmenschen in den Dreissigerjahren, in: Ernst (Jg. 21), Nr. 23, S. 26-29.
Lustbader, Ken (2023): Charlotte Charlaque Residence, entry in: New York City LGBT Historic Sites Project.
Meyerowitz, Joanne (2002): How Sex Changed. A History of Transsexuality in the United States. Cambridge und London: Harvard University Press, S. 30, 48-49.
Rustin, Richard (1963): Death Ends Proud Reign of the Promenade’s Queen, in: Brooklyn Heights Press, 14.2.1963, S. 1, 3.
Wolfert, Raimund (2015): „Sage, Toni, denkt man so bei euch drüben?“ Auf den Spuren Curt Scharlachs alias Charlotte Charlaques. In: Lambda Nachrichten (Jg. 37), Nr. 1, S. 38-41.
Wolfert, Raimund (2015): „Sage, Toni, denkt man so bei euch drüben?“ Auf den Spuren von Curt Scharlach alias Charlotte Charlaque (1892–?) und Toni Ebel (1881–1961), auf Online-Projekt Lesbengeschichte.
Wolfert, Raimund (2015): Curt Scharlach alias Charlotte Charlaque, eine biographische Skizze, in: Mitteilungen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft Nr. 52, S. 42-46.
Wolfert, Raimund (2021): Charlotte Charlaque. Transfrau, Laienschauspielerin, „Königin der Brooklyn Heights Promenade“. Berlin/Leipzig: Hentrich & Hentrich.
Christina von Schweden (schwedische Königin) geb. 7. oder 8.12.1626 (Stockholm, Schweden) – gest. 19.4.1689 (Rom, Italien)
Zur Biografie


Christina von Schweden übernahm 1644 im Alter von 18 Jahren die Regierungsgeschäfte, nachdem ihr Vater bereits 1632 auf dem Schlachtfeld bei Lützen südwestlich von Leipzig (im heutigen Sachsen-Anhalt) gestorben war. Sie erwies sich als energische und bestimmte Herrscherin, schloss unter anderem den Friedensvertrag ab, mit dem der Dreißigjährige Krieg beendet wurde, führte einen prunkvollen Hof und machte sich als Förderin der Künste und Wissenschaften weit über die Grenzen ihres Heimatlandes hinaus einen Namen.
Über ihr Privatleben gab es schon zu ihren Lebzeiten Spekulationen. Belegt ist, dass Christina von Schweden 1644 eine langjährige Liebesbeziehung mit ihrer Hofdame Ebba Sparre (1626–1662) einging, die bis zu Sparres Tod währte. 1654 dankte Christina von Schweden nach zehnjähriger Regierungszeit zugunsten eines Vetters ab. Offiziell begründete sie ihren Entschluss damit, dass sie nicht heiraten wolle. Sie verließ Schweden und reiste in Männerkleidern durch Dänemark und die deutschen Länder nach Brüssel, wo sie zunächst heimlich zum Katholizismus übertrat – ihr öffentliches Glaubensbekenntnis erfolgte wenig später in Innsbruck. Sie ließ sich schließlich in Rom nieder, wo sie am 19. April 1689 auch verstarb.
Christinas Verhältnis zur traditionellen Frauenrolle ist lange ein Thema der Forschung gewesen. Angeführt wurden immer wieder Christinas ausgeprägte Abneigung gegen die Institution Ehe und eine gewisse Frauenfeindlichkeit, die in ihren Schriften zum Ausdruck kommt. Die Vermutung, bei Christinas Geburt habe man sich in ihrer Geschlechtszuweisung geirrt, und der Umstand, dass sie als unverheiratete Frau nach ihrer Abdankung ein ungewöhnlich freies Leben führen konnte, haben dazu beigetragen, dass einige Forscher in ihr einen „Pseudo-Hermaphrodit“ sahen, also einen Menschen, der äußerlich gesehen mit den für sein Geschlecht typischen Genitalien geboren wurde, hormonell aber dem anderen Geschlecht angehörte. Diese These stellte 1937 etwa der schwedische Gynäkologe Elis Essen-Möller (1870–1956) auf.
Andere Forscher haben Christina von Schweden eine „Sexualneurose“ nachgesagt, was unter anderem dazu führte, dass ihr Grab 1965 unter der Leitung des schwedischen Anatomen Carl-Herman Hjortsjö (1914–1978) geöffnet wurde. Hjortsjö wies 1966 in einem Buch über die Graböffnung darauf hin, dass Christina von Schweden nach den an ihrem Skelett durchgeführten Untersuchungen eine „ganz normale Frau“ gewesen sei. Hjortsjö zufolge ließen sich die Schlussfolgerungen Essen-Möllers wissenschaftlich nicht belegen.
Für Magnus Hirschfeld war Christina von Schweden vor allem ein Paradebeispiel dafür, dass nicht alle Frauen „Margarethen“ seien, ebenso wenig wie alle Männer „Fauste“. Für Hirschfeld vereinigten sich in jedem Individuum männliche wie weibliche Anteile menschlicher Eigenschaften, wodurch jeder Mensch in einem ganz eigenen Mischungsverhältnis eine „Zwischenstufe“ sei. Hirschfeld betonte, es gebe Frauen, „welche wie Christine von Schweden an Energie und Großzügigkeit, wie Sonja Kowalewsca an Abstraktheit und Tiefe, wie viele moderne Frauenrechtlerinnen an Aktivität und Ehrgeiz, welche an Vorliebe zu männlichen Spielen wie Turnen und Jagen, an Härte, Rohheit und Tollkühnheit den Mann hoch überragen. Es giebt nicht eine spezifische Eigenschaft des Weibes, die sich nicht auch gelegentlich beim Mann, keinen männlichen Charakterzug, der sich nicht auch bei Frauen fände.“
Weiterführende Literatur
Herzer, Manfred (2017): Magnus Hirschfeld und seine Zeit. Berlin/Boston: De Gruyter, S. 53 und 94.
Hirschfeld, Magnus (1896): Sappho und Sokrates oder Wie erklärt sich die Liebe der Männer und Frauen zu Personen des eigenen Geschlechts? Von Dr. med. Th. Ramien. Leipzig: Max Spohr, S. 27.
Hirschfeld, Magnus (1899): Die objektive Diagnose der Homosexualität. In: Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen 1, S. 4-35, hier S. 21.
Hjortsjö, Carl-Herman (1967): Drottning Christina. Gravöppningen i Rom 1965. En kulturhistorisk och medicinsk-antropologisk undersökning. Lund: Corona Förlag.
Hoechstetter, Sophie (1908): Christine, Königin von Schweden in ihrer Jugend, in: Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen (Jg. 7), S. 169-190.
Rodén, Marie-Louise (2018): Kristina, drottning, in: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon.
Schröder, Hiltrud (1988): Christina von Schweden, auf Fembio Frauen.Biographieforschung.
Stolpe, Sven (1962): Königin Christine von Schweden („Drottning Kristina“). Frankfurt am Main: Verlag Knecht.
Zahn, Leopold (1953): Christine von Schweden. Königin des Barock: Köln, Berlin: Kiepenheuer & Witsch.
Cohn, Lore (Sekretärin, Redakteurin) geb. 8.2.1904 (Dessau) – gest. 2.8.1974 (Lausanne, Schweiz)
Zur Biografie
Lore Cohn war 1933 vorübergehend Magnus Hirschfelds Sekretärin in Paris. Sie war am 8. Februar 1904 unter dem Namen Lore Marcus in Dessau geboren worden und hatte nach dem Schulabschluss eine Ausbildung in Schreibmaschine, Stenografie und englisch- und französischsprachiger Handelskorrespondenz absolviert. 1930 heiratete sie den jüdischen und sozialistischen Rechtsanwalt Heinz Cohn (1903–1994), mit dem sie noch 1933 über die Schweiz nach Paris flüchtete. Hier wurde Lore Cohn als Sekretärin, Übersetzerin und Lehrerin tätig und arbeitete ähnlich wie ihr Mann einige Zeit für Hirschfeld.
1937 zog das Ehepaar nach Nizza (Südfrankreich) und ging von dort vorübergehend ins nahe gelegene Cagnes. Ab dem Frühjahr 1940 wurde Lore Cohn als Deutsche im Internierungslager Camps de Gurs festgehalten, doch gelang ihr die Flucht, als sich die deutsche Wehrmacht dem Lager näherte. Unter großen Entbehrungen konnte sie nach Cagnes zurückkehren. Im Herbst 1942 flüchtete sie vor der drohenden Deportation in die Schweiz, wo sie 1943 erneut interniert, wegen gesundheitlicher Beschwerden ein paar Monate später aber wieder entlassen wurde.
Lore Cohn engagierte sich wie ihr Mann Heinz Cohn in der jüdischen Flüchtlingshilfe. Ihre Berufstätigkeit musste sie 1956 aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Sie starb am 2. August 1974 in Lausanne.
Weiterführende Literatur
Bergemann, Hans, Ralf Dose und Marita Keilson-Lauritz. Hrsg. (2019): Magnus Hirschfelds Exil-Gästebuch. Berlin, Leipzig: Hentrich & Hentrich, S. 17 und 209.
Dauthendey, Elisabeth (Schriftstellerin) geb. 19.1.1854 (St. Petersburg, Russland) – gest. 18.4.1943 (Würzburg)
Zur Biografie


Als Elisabeth Dauthendey knapp zehn Jahre alt war, zog ihre Familie nach Deutschland zurück und ließ sich in Würzburg nieder. Die Tochter legte ein Lehrerinnenexamen und arbeitete zunächst als Hauslehrerin und Erzieherin bei Verwandten ihrer Mutter im ostpreußischen Königsberg, dann in London. Aus gesundheitlichen Gründen kehrte sie jedoch bald wieder nach Würzburg zurück und wurde im Haushalt und im Atelier ihres Vaters tätig.
Elisabeth Dauthendey legte ihre erste Veröffentlichung, in der sie sich bereits mit der Frauenfrage beschäftige, 1894 vor. Vier Jahre später erschien ihr erster Roman Im Lebensdrange. Im Laufe der Zeit schrieb Elisabeth Dauthendey über zwanzig Bücher, vornehmlich Romane, Novellen, Essays und Märchen, in denen sie sich für Frauenrechte stark machte.
1898 gründete sich in Würzburg der Frauenbildungsverein „Frauenheil“, den Elisabeth Dauthendey von Anfang an unterstützte. Als der Verein ein Jahr später den Antrag stellte, ausgewählte Vorlesungen an der Würzburger Universität besuchen zu dürfen – Frauen war damals das Universitätsstudium in Deutschland noch nicht erlaubt –, gehörte Elisabeth Dauthendey zu den Unterzeichnerinnen.
Anfang des 20. Jahrhunderts reiste Elisabeth Dauthendey viel. Sie besuchte Italien, Frankreich und Großbritannien und hielt sich mehrfach in Berlin, Dresden und München auf. Belegt ist, dass sie am 6. April 1906 auf einer Vierteljahresversammlung des Wissenschaftlich-humanitären Komitee (WhK) eigene Werke vortragen sollte. Sie musste die Veranstaltung aber kurzfristig absagen, da sie heiser geworden war. Stattdessen „sprang eine der anwesenden Damen in liebenswürdigster Weise in die Bresche und trug die Einleitung zu Frl. Dauthendey’s Buch ‚Vom neuen Weibe und seiner Liebe‘, sowie eine der ‚Romantischen Novellen‘ vor“, wie es im nachfolgenden Monatsbericht des Wissenschaftlich-humanitären Komitees hieß. Im selben Jahr war Elisabeth Dauthendey auch mit dem Essay „Die urnische Frage und die Frau“ im Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen (JfsZ) vertreten, in dem sie sich allerdings zu den „Normalen”, also „nicht urnisch veranlagten Individuen” zählte.
Elisabeth Dauthendey übersetzte auch aus dem Dänischen, zu ihrer Übersetzung von Carl Lambeks Zur Harmonie der Seele. Studien über Kultivierung des psychischen Lebens (1907) schrieb die schwedische Reformpädagogin Ellen Key ein Vorwort. Auch als Elisabeth Dauthendeys Vom neuen Weibe und seiner Liebe 1902 auf Schwedisch erschien, schrieb Key ein Vorwort zu dem Werk, verschwieg dabei aber das eigentliche Thema des Buches: die Liebe zwischen Frauen.
Nach 1933 wurde Elisabeth Dauthendey von den Nationalsozialisten als „Halbjüdin“ gebrandmarkt, und ihr Name wurde in der Öffentlichkeit nur noch selten genannt. Sie selbst reagierte auf die Ausgrenzung mit schriftstellerischer Enthaltung, um möglichst wenig Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Die letzten Jahre verbrachte sie in häuslicher Gemeinschaft mit einer Lebensgefährtin und in großer finanzieller Not. Ihr Nachlass, zu dem sie einen befreundeten Würzburger Lehrer bestimmt hatte, verbrannte bis auf ein einziges erhaltenes Manuskript im Zuge der verheerenden Bombenangriffe auf Würzburg vom 16. März 1945, denen bis zu 5.000 Menschen und etwa neunzig Prozent der historischen Altstadt zum Opfer fielen.
Schriften (Auswahl)
Dauthendey, Elisabeth (1894): Die Geschlechter. Essay, in: „Die Gesellschaft“, Hrsg. v. Michael Georg Conrad. Leipzig: Friedrich.
Pauloff, Andrea [Pseudonym für Elisabeth Dauthendey] (1895): Unweiblich. Essay, in: „Die Gesellschaft“, Hrsg. v. Michael Georg Conrad. Leipzig: Friedrich.
Dauthendey, Elisabeth (1900): Vom neuen Weibe und seiner Liebe. Ein Buch für reife Geister. Berlin: Schuster & Loeffler.
Dauthendey, Elisabeth (1906): Die urnische Frage und die Frau. In: Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen (Jg. 8), S. 286-300.
Dauthendey, Elisabeth (1907): Romantische Novellen. Leipzig: Thüringer Verlagsanstalt.
Dauthendey, Elisabeth (1919): Erotische Novellen. Berlin: Schuster & Loeffler.
Dauthendey, Elisabeth (2022): Das Weib denkt. Essays, Novellen, Gedichte und Märchen einer frühen Frauenrechtlerin. Würzburg: Königshausen & Neumann.
Weiterführende Literatur
Borgström, Eva (2012): Frida Stéenhoff, Ellen Key och den samkönade kärleken, in: Tidskrift för genusvetenskap, nr. 3, S. 35-59.
Dohm, Hedwig, Anita Augspurg, Helene Stöcker, Adele Schreiber, Grete Meisel-Heß u.a. (1912): Ehe? zur Reform der sexuellen Moral. Berlin: Internationale Verlagsanstalt für Kunst und Literatur.
Monatsbericht des Wissenschaftlich-humanitären Komitees (WhK), 1.5.1906 (Jg. 5, Nr. 5), [S. 1].
Osthoff, Daniel (2022): Elisabeth Dauthendey – eine biographische Annäherung, in: Dauthendey, Elisabeth: Das Weib denkt. Essays, Novellen, Gedichte und Märchen einer frühen Frauenrechtlerlin. Würzburg: Königshausen & Neumann.
Roßdeutscher, Walter (2004): Elisabeth Dauthendey – Schriftstellerin und Frauenrechtlerin – wurde vor 150 Jahren in St. Petersburg geboren. In: Frankenland. Zeitschrift für fränkische Landeskunde und Kulturpflege, S. 209-210.
Hippeli, Georg (o.J.): Webauftritt zu Elisabeth Dauthendey [mit zahlreichen online-Dokumenten sowie Literatur- und Veranstaltungshinweisen].
Veranstaltungen
Veranstaltungswoche zu Elisabeth Dauthendey Würzburg liest ein Buch, 16. bis 25. Juni 2023.
Dohm, Hedwig (Schriftstellerin, Frauenrechtlerin) geb. 20.9.1831 (Berlin) – gest. 1.6.1919 (Berlin)
Zur Biografie


Wie ihren Schwestern kam Hedwig Schlesinger nur eine eingeschränkte Schulbildung zuteil. Sie musste früh die Schule verlassen, um im Haushalt der Familie zu helfen. Mit 18 Jahren wurde ihr indes der Besuch eines Lehrerinnenseminars gestattet. Hedwig Schlesinger heiratete 1853 Ernst Dohm (1819–1883), den Chefredakteur der satirischen Zeitschrift Kladderadatsch. Hedwig Dohm wurde Mutter von fünf Kindern, von denen eins schon früh verstarb. Eine ihrer Enkeltöchter war Katia Mann geb. Pringsheim (1883–1980), die Ehefrau von Thomas Mann.
1867 debütierte Hedwig Dohm mit der Studie Die spanische National-Literatur in ihrer geschichtlichen Entwicklung. Das Wissen zu dem Buch hatte sie sich autodidaktisch angeeignet. In den 1870er Jahren folgten mehrere Bücher, in denen sich Hedwig Dohm für die völlige rechtliche, soziale und ökonomische Gleichberechtigung von Frauen und Männern einsetzte. 1873 sprach sie sich als eine der ersten in Deutschland öffentlich für das Stimmrecht für Frauen aus. Hedwig Dohm forderte gleiche Bildungschancen für Mädchen wie für Jungen. Ihrer Überzeugung nach war die Erwerbstätigkeit der einzige Weg für Frauen, um nicht mehr im „Ehegefängnis“ zu landen und sich frei für oder gegen eine gleichberechtigte Partnerschaft mit einem Mann zu entscheiden. Die Mutterliebe war nach Hedwig Dohms Auffassung kein natürlicher Trieb, sondern weitgehend anerzogen. Hedwig Dohm machte sich dafür stark, Hausarbeit und Kindererziehung institutionell organisieren zu lassen, damit auch Mütter weiter ihrem Beruf nachgehen könnten.
Ihre Bücher machten Hedwig Dohm in weiten Kreisen bekannt, brachten ihr aber auch viel Kritik ein – nicht nur von männlicher Seite, sondern auch von Teilen der Frauenbewegung ihrer Zeit, denen Dohms Forderungen zu radikal waren. Die bürgerlichen Frauenrechtlerinnen konzentrierten sich damals auf Forderungen nach einer verstärkten schulischen Bildung für Mädchen und der Unterstützung lediger Mütter.
Hedwig Dohm schrieb ab Mitte der 1870er Jahre vorrangig eine Reihe von Lustspielen, Novellen und Romanen. Gut ein Jahrzehnt später wandte sie sich aber auch wieder der Frauenbewegung zu. Sie war unter anderem Mitbegründerin des Frauenvereins „Reform“, der sich für das Frauenstudium einsetzte, sie trat Minna Cauers „Verein Frauenwohl“ ein und war Mitglied von Helene Stöckers „Bund für Mutterschutz und Sexualreform“ (BfM). Im Ersten Weltkrieg gehörte Hedwig Dohm zu den wenigen Intellektuellen in Deutschland, die sich kompromisslos gegen den Krieg und für den Frieden aussprachen. Die Einführung des Frauenwahlrechts in Deutschland 1918 erlebte sie noch.
Wie eng sich die Beziehung und die Zusammenarbeit zwischen Hedwig Dohm und dem fast 40 Jahre jüngeren Magnus Hirschfeld gestaltete, ist nicht belegt. In einem Beitrag für das Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen aus Anlass von Hirschfelds 50. Geburtstag nannte Dohm Hirschfeld 1918 einen herausragenden Forscher und Denker, „Mann der Tat“, „idealgesinnten Menschenfreund“ und „Wohltäter der Menschen“. Anerkennend schrieb sie: „Selten wohl stimmten Herz und Kopf zusammen wie bei diesem grundgütigen und hochintelligenten Sexualpsychologen. Wer ihn persönlich kennt, kann nicht anders als ihn liebend verehren.“ Magnus Hirschfeld und seine Schwester Franziska Mann wiederum würdigten im selben Jahr Dohm, indem sie ihr ihre Flugschrift Was jede Frau vom Wahlrecht wissen muß! widmeten. Außerdem zitierte Hirschfeld Hedwig Dohm in seinem Monumentalwerk Geschlechtskunde (1928) mit Ausführungen zum Kampf der christlichen Kirche gegen die Geschlechtsliebe. Dieser Kampf, so Dohm und Hirschfeld, habe die Menschen lediglich „zur Gewissensquälerei und zu Heuchlern erzogen.“
Hedwig Dohm starb hochbetagt am 1. Juni 1919 in Berlin. Sie wurde auf dem Alten St.-Matthäus-Kirchhof in Berlin-Schöneberg beigesetzt. 2007 wurde dort vom Journalistinnenbund zunächst eine Gedenkstätte mit neuem Grabstein errichtet. Seit 2018 ist ihr Grab als Ehrengrabstätte der Stadt Berlin ausgewiesen.
Würdigungen
In mehreren deutschen Städten (so etwa in Berlin, Bremen, Saarbrücken und Stuttgart) gibt es heute Straßen und/oder Schulen, die nach Hedwig Dohm benannt sind. Der Journalistinnenbund verleiht seit 1991 jährlich die Hedwig-Dohm-Urkunde an Frauen, die sich durch herausragende journalistische Leistungen und frauenpolitisches Engagement hervorgetan haben (siehe hier). 2022 wurde vom Journalistinnenbund erstmals das Hedwig-Dohm-Recherchestipendium vergeben.
Schriften (Auswahl)
Dohm, Hedwig (1874): Die wissenschaftliche Emancipation der Frauen. Berlin: Wedekind & Schwieger (online hier)
Dohm, Hedwig (1876): Der Frauen Natur und Recht. Zur Frauenfrage. Zwei Abhandlungen über Eigenschaften und Stimmrecht der Frauen. Berlin: Wedekind & Schwieger (online hier)
Dohm, Hedwig (1902): Die Antifeministen. Ein Buch der Verteidigung. Berlin: Ferdinand Dümmlers Verlagsbuchhandlung (online hier)
Dohm, Hedwig (1903): Die Mütter. Ein Beitrag zur Erziehungsfrage. Berlin: S. Fischer.
Dohm, Hedwig, zusammen mit Anita Augspurg, Helene Stöcker, Adele Schreiber u.a. (1912): Ehe? zur Reform der sexuellen Moral. Berlin: Internationale Verlagsanstalt für Kunst und Literatur.
Dohm, Hedwig (1916): Der Friede und die Frauen. In: Kurt Hiller (Hrsg.): Das Ziel. Aufrufe zu tätigem Geist. München: Georg Müller, S. 167-170.
Dohm, Hedwig (1918): [Magnus Hirschfeld zum 50. Geburtstag], in: Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen (Jg. 18), Sonderheft der Vierteljahresberichte des WhK während der Kriegszeit, S. 74-75.
Weiterführende Literatur
Bock, Jessica (2021): Hedwig Dohm [für FrauenMediaTurm], in: Digitales Deutsches Frauenarchiv.
Brandt, Heike (1995): „Die Menschenrechte haben kein Geschlecht.” Die Lebensgeschichte der Hedwig Dohm (Jugendsachbuch): Weinheim und Basel: Beltz & Gelberg.
Duda, Sibylle und Luise F. Pusch (1994): Hedwig Dohm, auf: FemBio Frauen.Biographieforschung.
Hirschfeld, Magnus und Mann, Franziska (1918): Was jede Frau vom Wahlrecht wissen muß! Berlin: Alfred Pulvermacher (online hier zugänglich).
Hirschfeld, Magnus (1928): Geschlechtskunde (2. Band: Folgen und Folgerungen). Stuttgart: Julius Püttmann, S. 18.
Mann, Franziska (1919): Der Dichterin – Dem Menschen! Zum 9. Juni 1919 [mit Beiträgen von Hedwig Dohm, Ellen Key, Arthur Silbergleit und Magnus Hirschfeld]. Jena: Landhausverlag.
Meissner, Julia (1987): Mehr Stolz, ihr Frauen! Hedwig Dohm. Eine Biographie (Frauengeschichte, 49). Düsseldorf: Schwann.
Pailer, Gaby (2011): Hedwig Dohm (Meteore, 7). Hannover: Wehrhahn.
Rohner, Isabel (2010): Spuren ins Jetzt. Hedwig Dohm – eine Biografie. Sulzbach/Taunus. Helmer (siehe auch hier).
Schreiber, Adele (1914): Hedwig Dohm als Vorkämpferin und Vordenkerin neuer Frauenideale. Berlin: Märkische Verlagsanstalt.
Wolff, Kerstin (2018): Hedwig Dohm – scharfzüngige und pointierte Schriftstellerin, in: Linnemann, Dorothee (Hrsg.): Damenwahl! 100 Jahre Frauenwahlrecht (Schriften des Historischen Museums Frankfurt, 36). Frankfurt/Main: Societätsverlag, S. 50-51 (siehe auch hier).
Dost, Margarete (Verkäuferin) geb. 1.4.1879 (Berlin) – gest. 6.12.1956 (Berlin)
Zur Biografie
Margarete Dost gehörte zu den engsten Vertrauten Magnus Hirschfelds. Sie – „meine Freundin Margarete Dost“ – ist neben seinem früheren Angestellten Franz Wimmer und seinem ärztlichen Freund Leopold Hönig in Karlsbad (Karlovy Vary) die einzige Person, die in Hirschfelds Testament mit einem größeren Legat bedacht wurde, ohne Mitglied seiner weitläufigen Familie zu sein oder dass Hirschfeld ihr noch einen versprochenen Betrag schuldig gewesen wäre, wie dies bei Ellen Bækgaard der Fall war, die Karl Gieses Ausbildung finanziert hatte.
Angeblich war Margarete Dost Hirschfelds Freundin aus jungen Jahren. Adelheid Schulz erinnerte sich, dass sie zu Zeiten des Instituts für Sexualwissenschaft immer Zugang zu Hirschfeld hatte. Margarete Dost war spätestens seit 1907 Mitglied des Wissenschaftlich-humanitären Komitees (WhK), sie wurde 1911 zur „Obmännin” gewählt und gehörte zwischen 1920 und 1926 als erste Frau vorübergehend dem Vorstand des WhK an. Die letzten Jahre seines Bestehens (1926–1933) hatte das WhK wieder einen reinen „Männervorstand”.
Überliefert ist auch, dass Hirschfeld Margarete Dost bestimmte, den bulgarischen Transvestiten Michael Dimitroff beim Einkauf seiner Frauenkleider in Berlin zu begleiten und zu beraten, was dieser sehr bedauerte – er wäre lieber mit Adelheid Schulz einkaufen gegangen.
Außer dass sie dem Obmännerkollegium und später zeitweilig dem Vorstand des WhK angehörte, ist wenig über Margarete Dost bekannt. Sie war eine Schwester des Fotografen und Fotografie-Historikers Wilhelm Dost (1886–1964), der vor 1913 die Fotografien für Hirschfelds Bilderwand der sexuellen Zwischenstufen angefertigt hat. Sie wohnte zeitlebens in Berlin und war nicht verheiratet. Die Einwohnermeldekartei notiert als ihre Adressen: „Berlin-Mitte, Gerhardstr. 13”, „Berlin-Friedrichshain, Stendaler Str. 12”, „Berlin-Tiergarten, Unionstr. 2” und zuletzt „Berlin-Tiergarten, Derfflingerstr. 21”.
Margarete Dost nahm gemeinsam mit Magnus Hirschfeld am 12. August 1919 an der Trauerfeier für Ernst Haeckel in Jena teil (vgl. Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen 1919, S. 90). Hirschfeld sprach dort im Namen der Humboldt-Hochschule und der Berliner Ortsgruppe des Monistenbundes. Später hat Margarete Dost Hirschfeld zweimal in Paris besucht – zu Weihnachten 1933 und im Sommer 1934, wie aus ihren Einträgen in Hirschfelds Exil-Gästebuch hervorgeht.
1934 vermittelte Margarete Dost Magnus Hirschfeld den Rückkauf von über 2.000 Kilogramm Büchern, Manuskripten, Dokumenten, Fragebögen, Bildern und anderen Gegenständen, die sich einst im Institut für Sexualwissenschaft befunden hatten, aus einer Berliner Zwangsversteigerung. Der nationalsozialistische Zwangsverwalter hatte der Dr. Magnus Hirschfeld-Stiftung zuvor angeboten, sie könne ihre „wissenschaftlichen Sachen” für einen Gegenwert von 4.000 Reichsmark zurückerhalten.
Möglicherweise war Margarete Dost lesbisch. Als der Publizist und langjährige Mitarbeiter Hirschfelds im WhK Kurt Hiller Ende der 1940er Jahre die lesbische Journalistin Eva Siewert (1907–1994) kennenlernte und diese ihn brieflich nach Frauen aus dem Umfeld Hirschfelds fragte, nannte Hiller ihr gegenüber den Namen Dosts und den von Gertrud Topf. Eva Siewert antwortete: „Die Damen Dost und Topf dürften schwer wiederzufinden sein. Schade, schade. Ich kannte sie nicht.“
1965 hieß es in der Zeitschrift für Freikörperkultur Helios, Magnus Hirschfeld habe sich stets für Frieden und Verständigung unter den Menschen sowie den Schutz von Minderheiten eingesetzt: „Das bezog sich auch auf die uneheliche Mutterschaft und die Homosexuellen. Zu Unrecht ist er deswegen selbst als homosexuell angesehen worden. Seine Frau starb 1954 in Berlin; er selbst als Flüchtling und Jude im Exil 1936.” Diese Bemerkungen sind gleich in mehrfacher Hinsicht fehlerhaft. Mit Hirschfelds Frau war offenbar Margarete Dost gemeint, die am 6. Dezember 1956 in Berlin verstarb.
Weiterführende Literatur
Anonym (1965): Wussten Sie das schon? In: Helios – Sonnenstrahl. Schriftenreihe für natürliche Lebensgestaltung. Nr. 158, S. 28.
Bergemann, Hans, Ralf Dose und Marita Keilson-Lauritz. Hrsg. (2019): Magnus Hirschfelds Exil-Gästebuch. Unter Mitarbeit von Kevin Dubout. Leipzig, Berlin: Hentrich & Hentrich, S. 209-210.
Herzer, Manfred (2017): Magnus Hirschfeld und seine Zeit. Berlin/Boston: De Gruyter Oldenbourg, S. 102, 375-376.
Drumm, Else (Pianistin, Klavierlehrerin) geb. 8.1.1892 (Kaiserslautern) – gest. 18.5.1954 (Heidelberg)
Zur Biografie
„Fräulein” Else Drumm gehörte neben Gertrud Topf, Toni Schwabe, Johanna Elberskirchen und Helene Stöcker als eine der ersten „weiblichen Obmänner” ab 1914 dem Obmännerkollegium des Wissenschaftlich-humanitären Komitees (WhK) an. In dieser Funktion wurde sie 1920 bestätigt. Im Übrigen liegen über die Identität Else Drumms nur wenig verlässliche Angaben vor. Es könnte sich um die Heidelberger Klavierlehrerin Elisabetha Friederike Dorothea Amalie Drumm gehandelt haben, Tochter des Musiklehrers Rudolph Drumm und seiner Ehefrau Amalie Martha geb. Fickeisen.
Else Drumm hat in Berlin das Stern’sche Konservatorium der Musik besucht. Von September 1906 bis Ende August 1908 findet sie sich im Schülerverzeichnis, das in den Jahresberichten abgedruckt ist. Sie stammte gebürtig aus Kaiserslautern und wurde Schülerin des Pianisten Otto Voss (1875–1946), der ab 1909 Direktor eines Konservatoriums in Heidelberg war. Anscheinend hat sie ihren Vornamen zu „Else” verkürzt, denn mit diesem Namen steht sie sowohl im Schülerverzeichnis des Stern’schen Konservatoriums als auch im Heidelberger Adressbuch. Nach Heidelberg ist Else Drumm 1917 von Kaiserslautern kommend gezogen – zusammen mit ihrer Mutter, die 1920 in Heidelberg verstorben ist. Im Heidelberger Adressbuch ist sie mit wechselnden Adressen verzeichnet: 1924/25 Kornmarkt 2, 1930 Kornmarkt 8, 1935 Landfriedstr. 16 und 1940 Märzgasse 16.
Anfang der 1910er Jahre galt Else Drumm als eine „eminent begabte Pianistin”, die von den Musikkritikern des General-Anzeigers der Stadt Mannheim und Umgebung wiederholt in höchsten Tönen gelobt wurde. Die Nennung ihres Namens zusammen mit denen anderer hervorragender Künstler und Künstlerinnen bei Ankündigungen von Symphoniekonzerten genüge, um etwa den „großen und prächtigen Saal” in Neustadt an der Weinstraße bis auf den letzten Platz zu füllen. Am 19. Juli 1913 wirkte Else Drumm zusammen mit der Pianistin Alwine Möslinger – die zwei Frauen spielten auf zwei Klavieren – an einer Prüfungsaufführung der Heidelberger Musikakademie mit, die laut dem Kritiker des General-Anzeigers der Stadt Mannheim und Umgebung „weit über das hinausragte, was man sonst von Schülerproduktionen zu hören gewohnt ist.”
Da Else Drumm ihre Ausbildung in Berlin im Alter von vierzehn Jahren begonnen hat, könnte sie bei Verwandten der Familie gelebt haben: väterlicherseits etwa den Kaufleuten Julius oder Max Drumm, mütterlicherseits bei dem Kaufmann Gustav Fickeisen, dem Mützenmacher Jacob Fickeisen oder auch bei der Witwe Fickeisen in Rixdorf. Sie wäre dann sehr jung mit dem WhK in Verbindung gekommen und kurz nach ihrer Volljährigkeit Obfrau geworden.
Quellen und weiterführende Literatur
Boxhammer, Ingeborg und Christiane Leidinger (2020): Ereignisse im Kaiserreich rund um Homosexualität und „Neue Damengemeinschaft“ (hier: ND). LGBTI-Selbstorganisierung und Selbstverständnis, S. 8. Online hier.
ck. (1910): Theater, Kunst und Wissenschaft, in: General-Anzeiger der Stadt Mannheim und Umgebung, 20.7.1910, S. 4.
ck. (1913): Kunst, Wissenschaft und Leben, in: General-Anzeiger der Stadt Mannheim und Umgebung, 21.7.1913, S. 3.
N. (1913): Kunst, Wissenschaft und Leben, in: General-Anzeiger der Stadt Mannheim und Umgebung, 9.4.1913, S. 3-4.
Dumont, Louise (Schauspielerin, Theaterleiterin) geb. 22.2.1862 (Köln) – gest. 16.5.1932 (Düsseldorf)
Zur Biografie


Sechs Jahre später, 1888, erhielt Louise Dumont ihr erstes Engagement am Königlichen Hoftheater in Stuttgart. Von Stuttgart wechselte sie jedoch schon 1898 erneut nach Berlin, wo sie am Deutschen Theater ihre größten Erfolge feiern konnte – insbesondere als Darstellerin der zentralen Frauengestalten in den Stücken des norwegischen Dramatikers Henrik Ibsen, etwa als Hedda Gabler.
Louise Dumont lernte 1903 Gustav Lindemann (1872–1960) kennen, und im folgenden Jahr gründeten die zwei das Schauspielhaus Düsseldorf, dem eine eigene Theaterakademie angegliedert war. Die Schule von Louise Dumont und Gustav Lindemann sollte durch so berühmte Absolventen wie Gustaf Gründgens (1899–1963) und Wolfgang Langhoff (1901–1966) nachhaltigen Einfluss auf das deutsche Theaterleben im Zwanzigsten Jahrhundert ausüben.
Nach der Einführung des allgemeinen Wahlrechts auch für Frauen in Deutschland gehörte Louise Dumont neben ihren Künstlerkolleginnen Gertrud Eysoldt und Käthe Kollwitz, den Schriftstellerinnen Lou Andreas-Salomé und Grete Meisel-Hess sowie den beiden Frauenrechtlerinnen und Publizistinnen Adele Schreiber und Helene Stöcker zu den sieben erstunterzeichnenden Frauen der Petition des Wissenschaftlich-humanitären Komitees (WhK) gegen den § 175 RStGB, der mann-männliche Sexualkontakte mit Strafe belegte.
Louise Dumont starb am 16. Mai 1932 in Düsseldorf an den Folgen einer Lungenentzündung. Die Deutsche Bundespost brachte 1976 in ihrer Serie „Berühmte Frauen” eine Briefmarke mit dem Motiv Louise Dumont als Hedda Gabler heraus.
Weiterführende Literatur (Auswahl)
Dahlmann, Christof (o.J.): Louise Dumont, auf Portal Rheinische Geschichte.
Kahnt, Antje (2016): Düsseldorfs starke Frauen – 30 Portraits. Düsseldorf: Droste, S. 79-84.
Liese, Wolf (1971): Louise Dumont. Ein Leben für das Theater. Hamburg/Düsseldorf: Marion von Schröder Verlag.
Quellen
Hirschfeld, Magnus (1921): Aus der Bewegung, in: Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen (Jg. 20), S. 107-142, hier S. 114-115.
Ebel, Toni (Malerin) geb. 10.11.1881 (Berlin) – gest. 9.6.1961 (Berlin)
Zur Biografie


1908 kehrte Toni Ebel nach Deutschland zurück, wo sie offenbar versuchte, sich an die gesellschaftlichen Anforderungen, die an sie gestellt wurden, anzupassen und sich in einer männlichen Rolle einzurichten. 1911 heiratete sie Olga Boralewski (1873–1928), die aus einer früheren Beziehung einen Sohn hatte. Die Ehe war jedoch sehr unglücklich. Toni Ebel unternahm mehrere Selbstmordversuche und wurde zeitweise in eine Heilanstalt eingewiesen.
1916 wurde Toni Ebel ebenfalls zum Kriegsdienst eingezogen. Als Gefreiter Arno Ebel machte sie im Ersten Weltkrieg Stellungskämpfe in Frankreich mit, wurde verschüttet und erlitt schließlich einen Nervenzusammenbruch. Sie wurde aus dem Kriegsdienst entlassen und als „Schwerbeschädigter“ anerkannt.
Nach der Ausrufung der Republik in Deutschland wurde Toni Ebel politisch aktiv. Sie engagierte sich zunächst in der SPD, dann in der USPD (Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands), und trat schließlich in die KPD ein. Nach dem Tod ihrer Ehefrau Olga Boralewski kam sie in Kontakt mit Magnus Hirschfeld und dem Institut für Sexualwissenschaft, um fortan ihre körperliche Geschlechtsangleichung voranzutreiben. Behilflich war ihr dabei ihre Freundin Charlotte Charlaque, eine gebürtige Deutsch-Amerikanerin, die als Curt Scharlach aufgewachsen war, weil auch ihre Eltern zunächst davon ausgegangen waren, dass sie ein Junge sei.
Toni Ebel arbeitete ähnlich wie Dora Richter, die heute in der Geschichte der Transsexualität als erster namentlicher „Fall” geschlechtsangleichender Operationen gilt, zeitweise als „Dienstmädchen“ im Institut für Sexualwissenschaft. 1928 erhielt sie einen sogenannten Transvestitenschein, der es ihr erlaubte, auch in der Öffentlichkeit als Frau gekleidet aufzutreten. Zu ihrer ersten geschlechtsangleichenden Operation kam es am 6. Januar 1929. Da war Toni Ebel bereits 47 Jahre alt. Ihrem Antrag, den Vornamen „Toni“ tragen zu dürfen, wurde im Februar 1930 stattgegeben, „Toni“ war indes nie ihr Wunschname gewesen.
Toni Ebel bestritt ihren Lebensunterhalt weitgehend durch ihre Kunst. Sie malte Porträts, Stilleben und Landschaftsbilder, trat aber auch als politische Werbezeichnerin und Theatermalerin in Erscheinung.
Zusammen mit ihrer Freundin Charlotte Charlaque, die Jüdin war, verließ Toni Ebel im Mai 1934 Deutschland und zog in die damalige Tschechoslowakei. Die beiden Frauen wohnten in Karlsbad (Karlovy Vary), Prag und Brünn (Brno), wo Toni Ebel bald als „ungebetene Ausländerin“ galt. Insbesondere nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht und der Errichtung des „Protektorats Böhmen und Mähren“ 1939 spitzten sich die Ereignisse um Toni Ebel und Charlotte Charlaque zu.
1942 wurde Charlotte Charlaque als amerikanische Staatsbürgerin nach Deutschland deportiert und vorübergehend in einem Internierungslager für Frauen und Kinder untergebracht. Sie erreichte die USA am 2. Juli 1942. Toni Ebel verblieb allein in Prag und wurde mehrfach von der Gestapo verhört, aber nicht interniert. Sie wurde Anfang 1945 als Deutsche aus der Tschechoslowakei ausgewiesen und musste unter Zurücklassung all ihrer Habe das Land verlassen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wohnte Toni Ebel wieder in Berlin. Sie ließ sich im Ostteil der Stadt nieder, wurde als „Opfer des Faschismus“ (OdF) anerkannt und kam in der frühen DDR als Malerin zu einer gewissen Berühmtheit. Sie gab sich ganz und gar staatstragend, zumal ihr vom „Arbeiter- und Bauernstaat“ DDR eine „Ehrenrente“ zugesprochen wurde, war mit Bildern in mehreren Kunstausstellungen vertreten, und 1956 wurde sie aus Anlass ihres 75. Geburtstags mit einer eigenen Kabinettausstellung im Alten Marstall in Ost-Berlin gewürdigt.
Toni Ebel starb am 9. Juni 1961 nach einer längeren schweren Krankheit in Berlin-Buch. Ihr Werk gilt heute bis auf wenige Bilder, die vornehmlich nach 1945 entstanden, als verschollen.
Weiterführende Literatur (Auswahl)
Abraham, Felix (1931): Genitalumwandlung an zwei männlichen Transvestiten, in: Zeitschrift für Sexualwissenschaft und Sexualpolitik (Jg. 18), Nr. 4, S. 223-226.
Ahlstedt, Ragnar (2021): Männer, die zu Frauen wurden. Zwei Fälle von Geschlechtsumwandlung auf operativem Weg. Eine Studie über das Wesen des Transvestitismus. In: Mitteilungen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft, Nr. 67, S. 33-40.
E., F. (1952): Das Portrait. Toni Ebel. In: Berliner Zeitung, 19.1.1952, S. 16.
Herrn, Rainer (2005): Schnittmuster des Geschlechts. Transvestitismus und Transsexualität in der frühen Sexualwissenschaft (Beiträge zur Sexualforschung, 85). Gießen: Psychosozial-Verlag, S. 203-204.
Ht (1956): Der Weg einer Künstlerin. In: Berliner Zeitung, 14.11.1956 (Nr. 267), S. 3.
K., E. (1961): Sie gehörte zu uns. Zum Tode Toni Ebels. In: Das Blatt (des Verbandes Bildender Künstler Deutschlands) (Jg. 12), Nr. 7/8, S. 18.
Rhan, L. (1932): Gespräch mit einer Frau, die einmal ein Mann war. In: Das 12 Uhr Blatt, 2.8.1932.
Wolfert, Raimund (2015): „Sage, Toni, denkt man so bei euch drüben?“ Auf den Spuren Curt Scharlachs alias Charlotte Charlaques. In: Lambda Nachrichten (Jg. 37), Nr. 1, S. 38-41.
Wolfert, Raimund (2015): „Sage, Toni, denkt man so bei euch drüben?“ Auf den Spuren von Curt Scharlach alias Charlotte Charlaque (1892–?) und Toni Ebel (1881–1961), auf Online-Projekt Lesbengeschichte.
Wolfert, Raimund (2021): Charlotte Charlaque. Transfrau, Laienschauspielerin, „Königin der Brooklyn Heights Promenade“. Berlin/Leipzig: Hentrich & Hentrich.
Ausstellung
Die Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft hat eine Ausstellung zu Leben und Werk Toni Ebels erarbeitet, die vom 24. September 2022 bis zum 31. Januar 2023 im Berliner Sonntags-Club gezeigt wurde. Auf der die Ausstellung begleitenden Webseite ist der Lebensweg Ebels in Text und Bild ausführlich dokumentiert (nachzulesen hier). Die Ausstellung soll und kann auf Wunsch auch an anderen Orten gezeigt werden. Anfragen bitte an: kontakt//at//toni-ebel.de .
Elberskirchen, Johanna (Naturärztin) geb. 11.4.1864 (Bonn) – gest. 17.5.1943 (Rüdersdorf bei Berlin)
Zur Biografie


Nachdem sie in ihre Heimatstadt Bonn zurückgekehrt war, engagierte sich Johanna Elberskirchen in der SPD, in der sie für einige Jahre den Vorsitz des Jugendausschusses übernahm. Sie wurde jedoch 1913 aus der Partei ausgeschlossen, da sie zeitgleich in einem bürgerlichen Frauenstimmrechtsverein aktiv war. Diese beiden Engagements galten damals aus sozialdemokratischer Sicht als nicht vereinbar.
1914 wurde Johanna Elberskirchen als Naturärztin in einem Sanatorium in Finkenwalde bei Stettin (heute Zdroje, ein Vorort von Szczecin, Polen) tätig. Wenig später zog sie nach Berlin, wo sie sich maßgeblich in der Säuglingsfürsorge engagierte. Zusammen mit ihrer Lebensgefährtin Hildegard Moniac (1891–1967) wohnte Elberskirchen ab 1920 in Rüdersdorf, südöstlich von Berlin. Hier engagierte sie sich wieder in der SPD und betrieb eine Homöopathische Praxis. Diese Praxis konnte sie bis an ihr Lebensende führen, auch wenn sie von Seiten der Nazis nach 1933 Berufseinschränkungen hinnehmen musste.


Johanna Elberskirchens Redebeitrag auf dem Wiener WLSR-Kongress wurde von den Zeitgenossen offenbar weitgehend übergangen, doch verstören ihre Worte vom September 1930 nach wie vor. In einer Zeit, in der sich die Weimarer Republik in einer tiefen Krise befand, prangerte die einstige Vorkämpferin der lesbischen Liebe eine „ungeheuerliche Zügellosigkeit der Libido sexualis“ in der Gegenwart an, sie wandte sich gegen die „Überbewertung des Sexualen in der Kultur“ und beschwor die Wiederkehr der „Reinheit der altgermanischen Jungfrauen und Jungmänner“.
Johanna Elberskirchen starb am 17. Mai 1943 im Alter von 79 Jahren. Die Urne mit ihren sterblichen Überresten wurde 1975 – über dreißig Jahre nach ihrem Tod – von zwei Frauen heimlich im Grab ihrer Lebensgefährtin Hildegard Moniac auf dem Rüdersdorfer Friedhof beigesetzt. Seit 2002 steht die gemeinschaftliche Grabstätte der beiden Frauen unter Schutz.
Schriften (Auswahl)
Elberskirchen, Johanna (1904): Was hat der Mann aus Weib, Kind und sich gemacht? Revolution und Erlösung des Weibes. Eine Abrechnung mit dem Mann – ein Wegweiser in die Zukunft! Berlin: Magazin-Verlag.
Gedenken
2003 fand auf dem Rüdersdorfer Friedhof eine Gedenkveranstaltung statt, an der einhundert Personen teilnahmen. Für Johanna Elberskirchen und ihre Lebensgefährtin Hildegard Moniac wurden Gedenktafeln aufgestellt. Seit Ende 2005 erinnert außerdem am Geburtshaus Elberskirchens in Bonn (Sternstraße 37, früher Nr. 195) eine Gedenktafel an die streitbare Feministin. Weiteres zur Rüdersdorfer Grabstätte siehe hier.
Weiterführende Literatur
Eggeling, Tatjana (o.J.): Johanna Elberskirchen, auf: Webseite der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld.
Leidinger, Christiane (2001): Johanna Elberskirchen und ihre Rüdersdorfer Zeit. Eine erste Skizze, in: Forum Homosexualität und Literatur, Nr. 39, S. 79-106.
Leidinger, Christiane (2003): Eine Urne im Pferdestall oder: die Geschichte einer geschützten Grabstätte und zweier Grabtafeln für Johanna Elberskirchen (1964–1943) und Hildegard Moniac (1891–1967), in: Mitteilungen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft, Nr. 35/36, S. 51-57.
Leidinger, Christiane (2008): Keine Tochter aus gutem Hause. Johanna Elberskirchen (1864–1943). Konstanz: UVK (Universitätsverlag Konstanz).
Leidinger, Christiane (2009): Johanna Elberskirchen, in: Sigusch, Volkmar und Günter Grau (Hrsg.): Personenlexikon der Sexualforschung. Frankfurt/New York: Campus, S. 125-127.
Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen. Hrsg. (2015): Persönlichkeiten in Berlin 1825–2006. Erinnerungen an Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen. Berlin, S. 26-27.
Werkbibliografie zu Johanna Elberskirchen und weiteres Material auf Lesbengeschichte.org.
Eysoldt, Gertrud (Schauspielerin) geb. 30.11.1870 (Pirna, Sachsen) – gest. 5.1.1955 (Ohlstadt, Bayern)
Zur Biografie


Nach dem Studium an der Königlichen bayerischen Musikschule in München spielte Gertrud Eysoldt zunächst am Münchner Hoftheater und dann in Meiningen, bevor sie 1891 am deutschsprachigen Stadttheater in Riga eine Anstellung fand. Der Direktor des Theaters, Max Martersteig (1853–1926), wurde drei Jahre später auch ihr Ehemann. Aus der Ehe ging ein Kind hervor, doch ließen sich Eysoldt und Martersteig schon wenig später wieder scheiden. 1893 wechselte Gertrud Eysoldt von Riga nach Stuttgart, von wo sie 1899 nach Berlin ging. Hier spielte sie an verschiedenen Theatern, unter anderem am Neuen Theater und am Deutschen Theater unter der Direktion von Max Reinhardt (1873–1943). 1910 wurde Gertrud Eysoldt zum zweiten Mal Mutter, und fünf Jahre später heiratete sie den Vater des Kindes. Ihr zweiter Mann, der Kunstmaler Benno Berneis (1883–1916) fiel im Zuge eines Einsatzes als Soldat im Ersten Weltkrieg.
Gertrud Eysoldt unterrichtete auch an der Schauspielschule des Deutschen Theaters und wurde 1920 schließlich Direktorin des Kleinen Schauspielhauses in Berlin-Charlottenburg. Zudem war sie dem noch jungen Medium Film gegenüber aufgeschlossen und wirkte gelegentlich an Stumm- und später Tonfilmproduktionen mit. Nachdem Max Reinhardt Deutschland 1933 verlassen hatte und ins Exil gegangen war, stand sie nur noch selten auf der Bühne.
Gertrud Eysoldt verließ 1943 das im Zuge der zunehmenden Luftangriffe unsicher gewordene Berlin und zog zu Freunden im bayrischen Ohlstadt. Dort verstarb sie am 5. Januar 1955.
Gertrud Eysoldt gilt wegen ihrer starken Frauenrollen auf der Bühne als „die erste Feministin des deutschen Theaters“. Magnus Hirschfeld und sie dürften sich persönlich mehrfach begegnet sein, schließlich war Gertrud Eysoldt auch mit dem Psychiater und Psychotherapeuten Arthur Kronfeld befreundet, der ab 1919 für etliche Jahre als „rechte Hand“ Hirschfelds am Institut für Sexualwissenschaft fungierte. Gertrud Eysoldt gehörte nach der Einführung des allgemeinen Wahlrechts auch für Frauen in Deutschland neben Lou Andreas-Salomé, Louise Dumont, Käthe Kollwitz, Grete Meisel-Hess, Adele Schreiber und Helene Stöcker zu den sieben erstunterzeichnenden Frauen der Petition des Wissenschaftlich-humanitären Komitees (WhK) gegen den § 175 RStGB, der mann-männliche Sexualkontakte mit Strafe belegte. Am 2. Februar 1924 nahm sie neben Käthe Kollwitz und etlichen anderen an einer Feierlichkeit im Institut für Sexualwissenschaft teil.
Weiterführende Literatur
Anonym (1924): Eine neue wissenschaftliche Stiftung in Berlin [Kurzmeldung unter „Kunst / Wissen / Leben“], in: Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung, 6.2.1924 (Jg. 82, Nr. 31), S. 2.
Hirschfeld, Magnus (1921): Aus der Bewegung, in: Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen (Jg. 20), S. 107-142, hier S. 114-115.
Niemann, Carsten (1995): „Das Herz meiner Künstlerschaft ist Mut.” Die Max-Reinhardt-Schauspielerin Gertrud Eysoldt. In: prinzenstraße. Hannoversche Hefte zur Theatergeschichte. Hannover: Niedersächsische Staatstheater Hannover.
Friedrichs, Hinrike (Wirtschafterin, Köchin) geb. 8.5.1872 (Brake, Oldenburg) – gest. 16.4.1938 (Berlin)
Zur Biografie
Hinrike (auch Hendricke und Henny) Friedrichs wurde am 8. Mai 1872 in Brake im Oldenburger Land geboren. Sie blieb zeit ihres Lebens unverheiratet und war nach eigenen Angaben 26 Jahre als Wirtschafterin und Köchin für Magnus Hirschfeld tätig. Demnach muss sie schon um 1906 begonnen haben, für Hirschfeld zu arbeiten. Ab 1927 wohnte sie nachweislich im Institut für Sexualwissenschaft, wo sie als Köchin arbeitete. Hirschfeld schätzte ihre Dienste sehr, und es heißt, sie war dem Sanitätsrat treu ergeben. Sie kochte seinen Kaffee so, wie er ihn sich wünschte, nämlich auf dem Kohlenherd, obwohl im Haus ein moderner Gasherd vorhanden war, sie ergänzte das Wirtschaftsgeld aus eigener Tasche, und wenn mehr Patienten unterzubringen waren, als es freie Räume im Institut gab, räumte sie sogar ihr Zimmer und schlief in der Küche.
Als sich Hinrike Friedrichs im Sommer 1928 ein Bein brach und in der Folge ihre Arbeit nicht mehr wie gewohnt verrichten konnte, übernahm vorübergehend Anni Kaschke aus Kolberg (Kołobrzeg) ihre Vertretung. Später kam dann die knapp 19jährige Adelheid Rennhack (später verheiratete Schulz) ins Institut. Als Hinrike Friedrichs in die Küche zurückkehrte, wurde Anni Kaschke entlassen, Adelheid Rennhack blieb.
Dass Hinrike Friedrichs über so lange Jahre für ihn gearbeitet hatte, veranlasste Magnus Hirschfeld 1929 dazu, sie in seinen testamentarischen Verfügungen zu berücksichtigen. Er vermachte ihr für die Zeit, die sie nicht mehr im Institut für Sexualwissenschaft arbeiten würde, eine monatliche Pension von 60 Mark. Von den Nazi-Behörden wurde Hinrike Friedrichs nach 1933 aber die kleine Rente aus dem Vermögen Hirschfelds verweigert.
Nach der Plünderung des Instituts wohnte Hinrike Friedrichs zunächst in der Burggrafenstraße 14 in Tiergarten-Süd, am 1. April 1936 zog sie nach Charlottenburg und bezog eine kleine Wohnung in der Nürnberger Straße 61. Hinrike Friedrichs verstarb am 16. April 1938 in den Wittenauer Heilstätten. Sie war 65 Jahre alt geworden.
Weiterführende Literatur
Dose, Ralf (2021): Haus-, medizinisches und Verwaltungspersonal des Instituts für Sexualwissenschaft. In: Mitteilungen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft, Nr. 67, S. 9-32, hier S. 15-17.
Fürst, Sidonie (Dr. med., Dermatologin) geb. 9.7.1891 (Tyrnau, heute Trnava, Slowakei) – gest. 18.9.1973 (New York, USA)
Zur Biografie


Sidonie Fürst wurde am 5. November 1926 zum Dr. med. promoviert und nahm anschließend eine Tätigkeit an der Dermatologischen Abteilung der Wiener Poliklinik unter der Leitung von Prof. Ernest Finger (1856–1939) auf. Sie spezialisierte sich dabei vor allem auf venerische Krankheiten und die Familienberatung. Später, wohl im Rahmen der Weltliga für Sexualreform (WLSR), beschäftigte sie sich mit den Berufswegen gleichgeschlechtlich begehrender und trans Menschen.
Sidonie Fürst und ihr späterer Mann Ludwig Vincenz Chiavacci (1896–1970) gehörten zum Organisationsteam des Wiener Kongresses der Weltliga für Sexualreform, der im September 1930 stattfand. Der Reader zum Kongress, der unter dem Titel „Sexualnot und Sexualreform“ erschien und den Sidonie Fürst 1931 zusammen mit ihrem Mann, Josef K. Friedjung und Herbert Steiner herausgab, gilt heute als ihr Hauptwerk.
Um 1930 wollte Magnus Hirschfeld Sidonie Fürst in eine leitende Position ans Berliner Institut für Sexualwissenschaft holen, doch die Pläne zerschlugen sich schon bald. Die Gründe hierfür sind unbekannt. Ursprünglich hatte Hirschfeld Fürst sogar für die Dauer seiner Weltreise (1931/32) als seine Vertretung am Institut vorgesehen, während Ludwig Vincenz Chiavacci als Hirschfelds Stellvertreter in Wien und Redakteur der mehrsprachigen WLSR-Zeitschrift Sexus fungieren sollte.
In seinem Testament Heft II schrieb Hirschfeld, dass er um 1930 nach der Fertigstellung der Geschlechtskunde erschöpft war und einen gewissen „Überdruss an der Bewegung“ verspürte, der ihm vor allem durch die Linsert-Hodann-Affäre entstanden war. Zudem machten ihm Spannungen mit anderen seiner Mitarbeiter*innen zu schaffen, und er litt unter den Mühen, für das Institut zufriedenstellende neue „Hilfskräfte“ zu finden. Zu seinen größten Enttäuschungen zählte er die „noch vor der Verwirklichung zerstörte Hoffnung Frau Dr. Fürst-Chiavacci“.
Ab Anfang der 1930er Jahre leitete Sidonie Fürst eine eigene ärztliche Praxis in Wien, und 1938 gelang ihr mit Unterstützung der British Federation of University Women (BFUW) und einem Affidavit der US-amerikanischen Frauenrechtlerin und Aktivistin für Geburtenkontrolle Margaret Sanger die Flucht aus Österreich über London in die USA.
Sidonie Fürst und Ludwig Vincenz Chiavacci heirateten erst im Sommer 1939 in London. Chiavacci fuhr am 19. August 1939 von Southampton aus nach New York, seine Frau konnte ihm erst vier Monate später, am 29. Dezember 1939, von Liverpool aus folgen.
In New York wurde Sidonie Chiavacci Assistentin an Margaret Sangers „Birth Control Clinical Research Bureau” (BCCRB), der einst ersten und damals nach wie vor größten Verhütungsklinik in den USA. Sie wurde 1946 von der amerikanischen Besatzungsmacht für eine Professur in Österreich vorgeschlagen, doch wurde der Vorschlag nie umgesetzt. In der Folge praktizierte sie bis etwa 1960 als Ärztin des österreichischen Generalkonsulats in den USA. Sidonie Chiavacci starb am 18. September 1973 im Alter von 82 Jahren in New York.
Schriften (Auswahl)
Friedjung, Josef K., Sidonie Fürst, Ludwig Chiavacci und Herbert Steiner. Hrsg. (1931): Sexualnot und Sexualreform. Verhandlungen der Weltliga für Sexualreform. IV. Kongress abgehalten zu Wien vom 16. bis 23. September 1930. Wien: Elbemühl. [Darin: Fürst, Sidonie: Das Problem der alleinstehenden Frau, S. 92-93.]
Weiterführende Literatur
Dose, Ralf. Hrsg.(2013): Magnus Hirschfeld. Testament Heft II. Berlin: Hentrich & Hentrich, S. 108.
Grossmann, Atina (2006): „Neue Frauen” im Exil. Deutsche Ärztinnen und die Emigration, in: Kirsten Heinsohn und Stefanie Schüler-Springorum (Hrsg.): Deutsch-jüdische Geschichte als Geschlechtergeschichte. Studien zum 19. und 20. Jahrhundert. Göttingen: Wallstein, S. 133-158.
Hubenstorf, Michael (1988): Vertriebene Medizin – Finale des Niedergangs der Wiener Medizinischen Schule?, in: Friedrich Stadler (Hrsg.): Vertriebene Vernunft, Bd. 2: Emigration und Exil österreichischer Wissenschaft. Wien: LIT-Verlag, S. 766-793, hier S. 790.
Kühl, Richard (2022): Auf dem Weg zu einer Charta der sexuellen Menschenrechte. Idee und Öffentlichkeit der Weltliga für Sexualreform (1928–1935), in: History | Sexuality | Law, 10/05/2022 (online hier).
Oertzen, Christine von (o.J.): Eintrag „Dr. med. Sidonie Fürst“ in der University Women’s International Networks Database (online hier).
Goldman, Emma (Anarchistin, Publizistin) geb. 27.6.1869 (Kowno, heute Kaunas, Litauen) – gest. 14.5.1940 (Toronto, Kanada)
Zur Biografie


Im Herbst 1919 wurde Emma Goldman aus politischen Gründen aus den USA nach Sowjetrussland ausgewiesen, wo sie bis Ende 1921 wohnte. Anschließend zog sie über Stockholm nach Berlin, wo sie Magnus Hirschfeld persönlich kennenlernte.
Im Zuge ihrer Bekanntschaft mit Hirschfeld schrieb Emma Goldman im März 1923 ebenfalls eine Erwiderung auf einen eigenwilligen Essay des österreichischen Schriftstellers Karl Freiherr von Levetzow (1871–1945), der die französische Anarchistin Louise Michel im Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen 1905 als „urnische“, das heißt lesbische Frau dargestellt hatte. Er hatte dabei auf die vermeintlich „männlichen“ Wesensmerkmale Michels verwiesen.
Goldman, die Michel Mitte der 1890er Jahre in England kennengelernt hatte, widersprach Karl von Levetzow in so gut wie allen Punkten und attestierte ihm ein völlig antiquiertes Frauenbild. Karl von Levetzow sehe, so Emma Goldman, „in der Frau ein Wesen, das von der Natur lediglich dazu bestimmt ist, den Mann mit seinem Liebesreiz zu erquicken, ihm Kinder zu gebären und im Übrigen als Kochtopf- und Strickstrumpfsklavin des Haushaltes zu figurieren.“
1923 schrieb Emma Goldman in ihrem Essay, sie kenne Hirschfelds Werke der Sexualpsychologie schon seit einer Reihe von Jahren und sie selbst sei stets ein „aufrichtiger Bewunderer“ von Hirschfelds „mannhaftem“ Eintreten für die Rechte von Menschen gewesen, „die ihrer ganzen natürlichen Veranlagung nach in dem, was man gemeinhin als den ‚normalen Weg‘ zu bezeichnen pflegt, keinen Ausdruck für ihre sexuellen Empfindungen finden können.“
Wenn Emma Goldman sich gegen die Auslegungen Karl von Levetzows in Hinblick auf Louise Michel verwehrte, ging es ihr, wie sie betonte, nicht darum, Michel von einem „Stigma“ zu reinigen. Im Gegenteil, Goldman betonte, unter ihren „männlichen und weiblichen Freunden“ befänden sich einige, die „entweder vollständig urnisch oder bisexuell veranlagt“ seien. „Ich fand dieselben, was Intelligenz, Fähigkeit, Feinfühligkeit und persönlichen Reiz anbelangt, weit über dem Durchschnittsmenschen stehend.“ Als Anarchistin, so Emma Goldman, sei ihr Platz stets auf der Seite der Verfolgten.
Wohl ebenfalls 1923 ließ Emma Goldman ihre Nichte Stella Comyn aus Amerika zu sich nach Berlin kommen, weil diese drohte zu erblinden. Mehrere Ärzte hatten ihr nicht helfen können und eine völlige Erblindung prognostiziert. Hirschfeld empfahl Goldman und ihrer Nichte den deutschen Augenarzt Maximilian Friedrich Joseph Graf von Wiser (1861–1938), der als Koryphäe auf seinem Fachgebiet galt und in Bad Liebenstein (Thüringen) praktizierte. Er konnte das Augenlicht Stella Comyns retten.
Ab 1924 lebte Emma Goldman in England und Frankreich. Am 28. November 1933 besuchte sie Magnus Hirschfeld in dessen Pariser Wohnung. Bei der Gelegenheit schrieb sie in sein Gästebuch: „In deepest regards and affection for your life long struggle for human freedom and individual rights.“ Emma Goldman stand nachweislich auch in engem Kontakt mit Meta Kraus-Fessel, die ab etwa 1924 wiederholt mit Hirschfeld zusammenarbeitete.
Magnus Hirschfeld bezeichnete Emma Goldman als eine „mutige, kluge und edle Frau“ und ehrte sie unter anderem dadurch, dass er ihr signiertes Porträt im Treppenhaus des Berliner Instituts für Sexualwissenschaft aufhängte.
Emma Goldman unterstützte ab 1936 die Anarchisten im Spanischen Bürgerkrieg und zog 1939 nach Kanada. Sie starb am 14. Mai 1940 in Toronto und blieb lange Zeit vergessen, bis sich Feministinnen einer jüngeren Generation der Vorkämpferin für Freiheit erinnerten.
Weiterführende Literatur
Bergemann, Hans, Ralf Dose und Marita Keilson-Lauritz. Hrsg. (2019): Magnus Hirschfelds Exil-Gästebuch. Unter Mitarbeit von Kevin Dubout. Leipzig, Berlin: Hentrich & Hentrich.
Goldman, Emma (1931): Living My Life. New York. Garden City Publishing Company, S. 948-949.
Goldmann, Emma (1923): Offener Brief an den Herausgeber der Jahrbücher über Louise Michel. In: Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen (Jg. 23), S. 70-92.
Jacob, Frank (2021). Emma Goldman. Ein Leben für die Freiheit. (Jüdische Miniaturen, 269). Leipzig: Hentrich & Hentrich.
Schräpel, Beate (o.J.): Emma Goldman, auf: Fembio. Frauen.Biographieforschung.
Hauck, Jenny (Schwester Magnus Hirschfelds) geb. 11.5.1875 (Kolberg, heute Kołobrzeg, PL) – gest. 17.2.1937 (Berlin)
Zur Biografie


Nach dem Tod ihrer älteren Schwester Agnes Hirschfeld erbte Jenny Hauck die Familienpension in Kolberg und führte sie unter dem Namen „Villa Agnes“ weiter. Eine regelmäßige Besucherin der Pension war bis 1931 die Schriftstellerin Else Lasker-Schüler.
Jenny Hauck besuchte ihren Bruder Magnus Hirschfeld in Berlin oft. Sie wohnte dann in einem der Gäste- oder Patientenzimmer im Obergeschoss des Hauses In den Zelten 10. Jenny Hauck wurde Mutter von zwei Kindern: Ihre Tochter Eva Hauck (1900–1924) starb in jungen Jahren an Scharlach, ihr Sohn Günter Rudi Hauck (1901–1976) flüchtete mit seiner Familie 1938 aus Deutschland zunächst nach Großbritannien und von dort weiter nach Australien.
Magnus Hirschfeld selbst hatte zu seiner Schwester Jenny wie auch zu seinen übrigen Geschwistern ein gutes Verhältnis. In seiner Autobiografie schrieb er Anfang der 1920er Jahre: „Das Band, das mich mit meinen beiden Brüdern, wie übrigens auch mit meinen vier Schwestern verknüpfte, war stets ein inniges, vor allem waren sie sämtlich – die einen etwas früher, die anderen später – von der Berechtigung und allmählich auch von der Bedeutung der Lebensarbeit ihres jüngsten Bruders durchdrungen.“
Jenny Hauck starb am 17. Februar 1937 im Jüdischen Krankenhaus in Berlin an einem Herzschlag.
Weiterführende Literatur
Dose, Ralf (2004): Die Familie Hirschfeld aus Kolberg. In: Elke-Vera Kotowski und Julius H. Schoeps (Hrsg.): Magnus Hirschfeld. Ein Leben im Spannungsfeld von Wissenschaft, Politik und Gesellschaft (Sifria. Wissenschaftliche Bibliothek, 8). Berlin: be.bra wissenschaft, S. 33-64.
Herzer, Manfred (2017): Magnus Hirschfeld und seine Zeit. Berlin: De Gruyter Oldenbourg, S. 16, 22, 399.
Lasker-Schüler, Else (2017): Kolberg. Als man dort noch nicht von Hakenkreuzlern bedroht wurde. In: Mitteilungen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft, Heft 57, S. 27-29.
Hehner, Liselotte (Sozialarbeiterin) geb. 19.4.1904 (Berlin) – gest. 5.9.2006 (Berlin)
Zur Biografie


Anschließend besuchte sie eine Frauenschule, in der sie Unterricht in Literatur, Englisch, Französisch, Handarbeit, Musik und Kochen hatte. Sie entschloss sich jedoch schon bald, eine Ausbildung zu machen, um mit Arbeit ihren Lebensunterhalt verdienen zu können. Nach einer vorübergehenden Tätigkeit für eine Im- und Exportfirma besuchte sie die soziale Frauenschule Anna-von-Gierke-Schule in Charlottenburg, um Sozialarbeiterin zu werden. Schon als Schülerin musste sie sich zunächst um Kleinrentner kümmern, erhielt dann aber bald vom Pflegeamt des Landeswohlfahrts- und Jugendamtes im Polizeipräsidium am Alexanderplatz 4 die Aufgabe, sozial schwache und benachteiligte Menschen zu betreuen: Arbeitslose, Fabrikarbeiterinnen, Prostituierte und Homosexuelle. So lernte sie auch die Bordelle und Kneipen des „lasterhaften Berlin“ kennen.
Liselotte Hehner betreute Frauen, die sich Geschlechtskrankheiten zugezogen hatten, und Männer aus der Oberschicht, die wegen homosexueller Handlungen im Gefängnis saßen. Unter anderem beriet sie auch ein lesbisches Paar, das gemeinsam ein Kind angenommen hatte und pflegte. In dieser Zeit lernte sie auch Magnus Hirschfeld persönlich kennen. Rosa von Praunheim gegenüber sagte Liselotte Hehner über Hirschfeld später: „Er war sehr reizend, aber kurz, sachlich, interessiert für das, was man ihm sagte. Er wirkte untersetzt, sehr intelligente Augen. Er hörte sehr gut zu und ging sofort auf das ein, was man wollte.“
Liselotte Hehner arbeitete zwischenzeitig auch in einem Obdachlosenasyl in Prenzlauer Berg, blieb aber bis 1933 Mitarbeiterin des Pflegeamts am Alexanderplatz. Anschließend wurde sie als Berufsberaterin an Schulen tätig.
Ihren späteren Mann Hans-Joachim Laabs (1910–?) lernte Liselotte Hehner Anfang der 1930er Jahre kennen, als dieser noch Student war. Er promovierte 1934 und wurde Richter am Amtsgericht Charlottenburg. Weil jedoch inzwischen die Nazis an der Macht waren, sprang er von der Richterlaufbahn ab, um nicht Mitglied der NSDAP werden zu müssen, und wurde Justiziar der Preußischen Staatsbank. Liselotte Hehner und Joachim Laabs heirateten 1936, zogen in die Gervinusstraße in Charlottenburg, trennten sich aber 1950 wieder und ließen sich 1957 scheiden.
In den Anfangsjahren ihrer Ehe war Liselotte Laabs „zum Hausfrauendasein verurteilt“, wie sie selbst es ausdrückte. Nach einigen Jahren nahm sie deshalb Kontakt mit Helmut Selbach (1909–1987), Oberarzt an der Psychiatrischen Universitätsklinik der Charité, auf und bat ihn um eine Stelle als Fürsorgerin. Ihre Aufgabe bestand ab 1940 vor allem darin, mit den Angehörigen internierter Patienten zu sprechen. Ihr unmittelbarer Vorgesetzter war der Psychiater Max de Crinis (1898–1945), und sie erfuhr im Lauf der Zeit, dass viele Patienten der Charité Opfer der Euthanasie wurden. Im Frühjahr 1945 arbeitete sie kurzfristig im Operationsbunker der Charité unter dem Chirurgen Ferdinand Sauerbruch (1875–1951). Ende 1946 hatte Liselotte Laabs schließlich einen prominenten Patienten in der Universitäts-Nervenklinik und Poliklinik der Charité zu betreuen, den Schriftsteller Hans Fallada (1893–1947), der von seiner Alkohol- und Morphiumsucht stark gezeichnet war.
Liselotte Laabs arbeitete ab 1952 erneut als Fürsorgerin, jetzt für das Deutsche Rote Kreuz, anschließend war sie bis 1970 als Bibliothekarin im Krankenhaus Wilmersdorf tätig. Im Alter von 66 Jahren wollte sie sich eigentlich zur Ruhe setzen, kehrte jedoch noch einmal zum Roten Kreuz zurück und ging erst 1975 in Rente.
Liselotte Hehner war 1960 in die Rankestraße nach Charlottenburg gezogen, wo sie bis zu ihrem Lebensende alleine wohnte. Sie war bis ins hohe Alter aktiv und umtriebig, veröffentlichte ihre Memoiren (unter ihrem Mädchennamen), lernte Rosa von Praunheim und Charlotte von Mahlsdorf (1928–2002) kennen und sprach mit der Schauspielerin Corinna Harfouch über deren Rolle als Eva Braun in einem Theaterstück am Berliner Ensemble.
Liselotte Hehner starb am 5. September 2006 im Alter von 102 Jahren in Berlin.
Weiterführende Literatur
Friedrich-Freksa, Jenny (2004): Voll das Leben. Interview mit der hundertjährigen Liselotte Hehner. In: Fluter. Magazin der Bundeszentrale für politische Bildung (12), S. 44-47, kostenloses PDF hier.
Füchsel, Katja (2004): Mit der Dietrich im Schulorchester. Lilo Hehner ist 100 Jahre alt. Die Memoiren der Berlinerin sind wieder im Buchhandel erhältlich. In: Der Tagesspiegel, 29.4.2004.
Füchsel, Katja (2006): Lilo Hehner (geb. 1904). „Das Alter hätte ich mir auch anders vorgestellt.” In: Der Tagesspiegel, 6.10.2006.
Kuhnke, Manfred (2001): Wir saßen alle an einem Tisch. Sekretärin und Krankenschwester, Pflichtjahrmädchen und Haustöchter erzählen von Hans Fallada. Neubrandenburg: federchen Verlag, S. 166-179.
Sapparth, Henry. Hrsg. (2000): Das Leben der Lilo Hehner. Kaleidoskop einer uralten Berlinerin. Berlin: edition HEWIS.
Schmitt, Peter-Philipp (2006): Für Hirschfeld im Milljö. Lilo Hehner betreute vor acht Jahrzehnten Prostituierte und Homosexuelle in Berlin. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2006 (Nr. 64), S. 9.
Film
Praunheim, Rosa von (1998): Schwuler Mut. 100 Jahre Schwulenbewegung (DVD). Berlin: Rosa von Praunheim Film.
Helling, Helene (Malerin, Hausdame) geb. verm. 26.5.1876 (Hamburg) – gest. verm. 5.5.1958 (Hamburg)
Zur Biografie


Die Identität von Helene Helling ist noch nicht abschließend geklärt. Vermutlich handelt es sich um die Malerin Helene Johanne Helling, am 26. Mai 1876 in Hamburg geboren wurde und dort am 5. Mai 1958 verstarb. Sie war unverheiratet, und über ihre Ausbildung ist nur bekannt, dass sie die Dresdener private „Malschule für Damen“ von Robert Sterl (1867–1932) besucht hat. Im Januar 1917 stellte sie zusammen mit den Malerinnen Gertrud Landsberger-Sachs (1885–1962), Hanna Mehls (1867–1928) und Else Mögelin (1887–1982) im „Verein der Künstlerinnen und Kunstfreundinnen zu Berlin”, Schöneberger Ufer 38, ihre Werke aus. Etwa zur gleichen Zeit war sie auch in einer Ausstellung der „Künstlervereinigung Dresden” vertreten.
An Helene Helling gibt es widersprüchliche Erinnerungen. Ellen Bækgaard erinnerte sich 1984: „In der Vorhalle saß eine reizende Dame, Frau Helling, an einem kleinen Schreibtisch und ‚empfing‘ und sortierte die Besucher – einen Teil schickte sie zum Nebenhaus, und anderen, die kamen, um Magnus Hirschfeld oder Karl Giese zu sehen oder sie zu besuchen, gab sie einen Termin oder ‚freies Geleit‘. Frau Helling war nicht angestellt im Institut und war nicht auf der Gehaltsliste, aber sie gehörte dazu. Sie war um 1930 eine Dame mittleren Alters – und absolut ‚Dame‘ im besten Sinne des Wortes. Ich habe nie ihre Verbindung zu Magnus Hirschfeld erfahren, weiß aber, daß sie zur gleichen Zeit, als Magnus Hirschfeld sich einrichtete, eine kleine Wohnung ganz oben im Palais bekam, wo sie mit ihrer eigenen Einrichtung einzog. Ich habe sie dort zum Nachmittagstee besucht, das war sehr gemütlich und kultiviert. Über sie persönlich weiß ich nur, daß sie Witwe war und ihren eigenen Haushalt führte.
Als sie dort kurze Zeit gewohnt hatte, sah sie, wie wenig System es in dem privaten Haus gab, so daß sie eines schönen Tages einen Schreibtisch in der Vorhalle aufstellen ließ und sich dort werktags von 9–16 Uhr etablierte, und sie bekam auch ein Haustelefon an ihrem Schreibtisch installiert. Von dem Tag an kam niemand unangemeldet hinein.“


Karl Giese hat weniger freundliche Erinnerungen an Helene Helling. Er sah sie 1933 auf einer politischen Linie mit Institutsmitarbeitern wie Arthur Röser, Ewald Lausch und Friedrich Hauptstein, die sich den nationalsozialistischen Machthabern mit einer Ergebenheitsadresse an Hermann Göring andienten.
Von Helene Helling war lange nur eine einzige Zeichnung überliefert: „Ohr-, Hals-, Arm- und Kopfschmuck einer Europäerin“ (Hirschfeld: Geschlechtskunde, S. 765). Die Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft konnte Anfang 2021 ein kleinformatiges Aquarell „Schlosspark“ von ihr erwerben.
Weiterführende Literatur und Quellen
Anonym (1917): Eine neue Ausstellung des Künstlerinnenvereins, in: Beilage der Berliner Börsen-Zeitung (Nr. 5), 4.1.1917.
Bækgaard, Ellen (1985): Das Sexualwissenschaftliche Institut in Berlin. In: Mitteilungen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft, Nr. 5, S. 32-35.
Dose, Ralf (2021): Haus-, medizinisches und Verwaltungspersonal des Instituts für Sexualwissenschaft. In: Mitteilungen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft, Heft 67, S. 9-32.
Everard, Myriam (1988): Eros in het museum. Aantekeningen bij Til Brugmans ‘Liefdeswarenhuis’, in: Lust en Gratie (Jg. 5), S. 66-77 (online hier). [Helene Helling wird in diesem Text fälschlicherweise als „Frau Heller” bezeichnet.]
ys (1916): Wissenschaft und Kunst. Künstlervereinigung Dresden, in: Sächsische Staatszeitung (Nr. 289), 13.12.1916, S. 10.
Heyl, Hedwig (Unternehmerin, Frauenrechtlerin) geb. 5.5.1850 (Bremen) – gest. 23.1.1934 (Berlin)
Zur Biografie


Hedwig Heyl wurde am 3. Mai 1850 in Bremen geboren. Ihr Geburtsname war Crüsemann. Sie besuchte das Mädchen-Erziehungsheim „Neu Watzum“ in Wolfenbüttel, heiratete im Alter von 18 Jahren den Fabrikanten Georg Heyl (1840–1889) und zog 1869 mit ihm nach Berlin. Hedwig Heyl wurde Mutter von fünf Kindern.
Zusammen mit ihrer früheren Lehrerin Henriette Schrader-Breymann (1827–1899) gründete Hedwig Heyl den „Berliner Verein für Volkserziehung“ und das „Pestalozzi-Fröbel-Haus“ in Schöneberg, in dem 1884 eine Koch- und Haushaltschule für Mädchen entstand. Wenige Jahre später wurden hier auch eine Seminar für Kindergärtnerinnen, eine Krabbelstube, ein Kindergarten und ein Hort eingerichtet.
Nach dem Tod ihres Mannes 1889 übernahm Hedwig Heyl die Leitung der Heyl’schen Farbenfabriken in Charlottenburg, vernachlässigte ihre soziale Arbeit zugunsten von benachteiligten Frauen und Kindern aber nicht. Zusammen mit Gleichgesinnten engagierte sie sich in mehr als zwanzig Einrichtungen der Wohlfahrts- und Bildungsvereine für Frauen.
1904 organisierte Hedwig Heyl den Internationalen Frauenkongress in Berlin, der mit Unterstützung der deutschen Kaiserin Viktoria abgehalten wurde und an dem Vertreterinnen aus 25 Ländern teilnahmen, vor allem aus dem bürgerlichen Spektrum. Ein Jahr später gründete sie zusammen mit Ellen von Siemens-Helmholtz (1864–1941) den „Deutschen Lyceum Club“, der Künstlerinnen und Wissenschaftlerinnen bei Ausstellungen und Veröffentlichungen unterstützen sollte. 1915 gehörte Hedwig Heyl zu den Gründungsmitgliedern des „Deutschen Hausfrauen-Bundes“, und 1920 wurde ihr die Ehrendoktorwürde der Universität Berlin verliehen.
Problematisch ist Heyls Engagement im Rahmen des „Frauenbundes der Deutschen Kolonialgesellschaft“, dessen Vorsitzende sie über mehrere Jahre war. Hier vertrat sie klar rassistische Positionen, indem sie sich etwa gegen sogenannte Mischehen zwischen Deutschen und Einheimischen in den deutschen Kolonien in Afrika aussprach. Heyl befürchtete eine „Verkafferung“ der „Kolonialeliten“ und sah es als eine ihrer zentralsten Aufgaben an, „geeignetes Mädchenmaterial“ in Deutschland zu finden, um es den Kolonisten zum Zweck der Eheschließung anzubieten. Ziel war die „Erhaltung des Deutschtums“ in Südwestafrika.
1933 zeigte sich Hedwig Heyl begeistert von Adolf Hitler. Nach ihrem Tod wurden in Deutschland mehrere Straßen nach Hedwig Heyl benannt. Dies wurde jedoch aufgrund ihres Engagements für den Kolonialismus zum Teil später wieder rückgängig gemacht. So wurde die Hedwig-Heyl-Straße in Oldenburg 2015 in Hilde-Domin-Straße umbenannt.
Schriften (Auswahl)
Heyl, Hedwig (1925): Aus meinem Leben. Weibliches Schaffen und Wirken. Berlin. C. A. Schwetschke & Sohn.
Klotz, Leopold. Hrsg. (1936): Ströme der Liebe. Ein Briefwechsel [zwischen Hedwig Heyl und Eugen Vinnai]. Gotha/Leipzig: Klotz.
Weiterführende Literatur und Quellen
Kachulle, Doris (1992): „Verschicke nur geeignetes Mädchenmaterial“. Die Bremerin Hedwig Heyl arbeitete im Deutsch-Kolonialen Frauenbund für die „Deutschwerdung“ Südwestafrikas, in: Die Tageszeitung. 21.3.1992, S. 35
Laudowicz, Edith (o.J.): Hedwig Henriette Heyl geb. Crüsemann, Eintrag auf Bremer Frauengeschichte.
Schicke, Sabine (2015): Stundenlange Debatte um Oldenburger Straßennamen, in: Nordwest-Zeitung, 1.7.2015 (online hier).
Schroeder, Hiltrud (o.J.): Hedwig Heyl, Eintrag auf FemBio Frauen.Biographieforschung.
Hirschfeld, Agnes (Schwester M. Hirschfelds) geb. um 1861 (Kolberg, heute Kołobrzeg, PL) – gest. um 1922 (Ort nicht belegt)
Zur Biografie
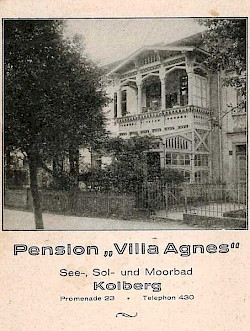

Es scheint indes, dass Agnes Hirschfeld zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt Kolberg und damit das Elternhaus verließ. Ihre Schwester Franziska Mann schrieb 1918 in einem Brief an den gemeinsamen Bruder Magnus Hirschfeld: „Sieben Wanderer haben vor Jahren jene Stadt am Meere verlassen …”. 1904, kurz nach dem Tod der Mutter Friederike Mann, übernahm Agnes Hirschfeld die Leitung der „Sanitätsrat Hirschfeldschen Familienpension” in ihrem Elternhaus an der Kolberger Promenade 23. Zwischen 1909 und 1912 inserierte sie mehrfach im Berliner Tageblatt und warb mit den Worten „schönste Lage, neu renoviert, beste Verpflegung, zivile Preise” für ihre Pension. Auf Wunsch bot sie auch „diätetische Küche nach ärztlichen Vorschriften”.
Nach dem Tod von Agnes Hirschfeld übernahm die Schwester Jenny Hauck die Pension und führte sie unter dem Namen „Villa Agnes” weiter. Regelmäßige Besucherin des Hauses war auch in frühen Jahren bereits die Dichterin Else Lasker-Schüler.
Weiterführende Literatur und Quellen
Diverse Anzeigen im Berliner Tageblatt und Handelszeitung, u.a. vom 30.5.1909, 20.6.1909, 16.6.1912, 23.6.1912 und 6.9.1912.
Dose, Ralf (2004): Die Familie Hirschfeld aus Kolberg. In: Elke-Vera Kotowski und Julius H. Schoeps (Hrsg.): Magnus Hirschfeld. Ein Leben im Spannungsfeld von Wissenschaft, Politik und Gesellschaft (Sifria. Wissenschaftliche Bibliothek, 8). Berlin: be.bra wissenschaft, S. 33-64.
Herzer, Manfred (2017): Magnus Hirschfeld und seine Zeit. Berlin: De Gruyter Oldenbourg, S. 22.
Lasker-Schüler, Else (2017): Kolberg. Als man dort noch nicht von Hakenkreuzlern bedroht wurde. In: Mitteilungen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft, Heft 57, S. 27-29.
Hirschfeld, Friederike (Magnus Hirschfelds Mutter) geb. 6.7.1838 (Bernstein, heute Pełczyce, Polen) – gest. 5.6.1904 (Berlin)
Zur Biografie
Die Mutter Magnus Hirschfelds wurde am 6. Juli 1838 in Bernstein an der Warthe (heute Pełczyce) geboren. Sie war eine Cousine ihres späteren Mannes Hermann Hirschfeld (1825–1885) aus dem hinterpommerschen Neustettin (Szczecinek). Die beiden hatten sich in Berlin kennen gelernt, wo Friederike Mann im Mädchenpensionat der Madame Seegmann erzogen wurde, und heirateten am 31. Mai 1855 in Kolberg (Kołobrzeg). Friederike Hirschfeld wurde Mutter von zehn Kindern, von denen drei sehr früh verstarben.
Friederike Hirschfeld und ihren jüngsten Sohn verband offenbar ein sehr inniges Verhältnis. Magnus Hirschfelds Schwester Franziska Mann schrieb 1918 in einem längeren Brief an ihren Bruder: „Du, lieber Magnus, bist der letzte von den Brüdern gewesen, der unsere Mutter verließ. Keinem hat sie mit größerer Sehnsucht nachgeschaut; keine Ferien-Wiederkehr mit größerem Verlangen herbeigesehnt. Immer brachtest Du Frohsinn mit und Anregung und einen Hauch dessen, was mit dem Tode unseres Vaters entflohen war.“ Magnus Hirschfeld selbst rühmte seine Mutter als „ein Wesen von unendlicher Sanftmut und Langmut“. Den Tod ihres Mannes, der im Sommer 1885 noch nicht sechzigjährig an einer Nierenkrankheit gestorben war, habe sie niemals verwunden. Friederike Hirschfeld überlebte ihren Mann um achtzehn Jahre und starb am 5. Juni 1904, nachdem sie von Kolberg nach Wilmersdorf bei Berlin umgezogen war.
In der Familie Hirschfeld wurde das traditionelle Rollenverständnis zwischen Männern und Frauen offenbar nicht in Frage gestellt. Hermann Hirschfeld soll seine Frau, die gut zwölf Jahre jünger als er selbst war, einmal mit „liebes Kind“ angeredet haben, so die Tochter Franziska Mann. Von keiner der vier Schwestern Magnus Hirschfelds ist bekannt, dass sie eine Berufsausbildung etwa als Lehrerin erhielt. Allem Anschein nach wurden alle auf ihren „natürlichen“ Beruf als Ehegattin und Mutter vorbereitet.
Von Magnus Hirschfelds Mutter Friederike Hirschfeld ist kein Bildnis bekannt.
Weiterführende Literatur
Dose, Ralf (2004): Die Familie Hirschfeld aus Kolberg. In: Elke-Vera Kotowski und Julius H. Schoeps (Hrsg.): Magnus Hirschfeld. Ein Leben im Spannungsfeld von Wissenschaft, Politik und Gesellschaft (Sifria. Wissenschaftliche Bibliothek, 8). Berlin: be.bra wissenschaft, S. 33-64.
Herzer, Manfred (2017): Magnus Hirschfeld und seine Zeit. Berlin: De Gruyter Oldenbourg, S. 15ff.
Hoechstetter, Sophie (Schriftstellerin) geb. 15.8.1873 (Pappenheim, Franken) – gest. 4.4.1943 (Künstlerkolonie Dachau)
Zur Biografie


Nach ihrer Freundin Toni Schwabe wurde Sophie Hoechstetter wohl 1916 zur fünften „Obfrau“ im Wissenschaftlich-humanitären Komitee (WhK) ernannt. Im Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen machte sie aber schon 1908 mit einem literarischen Portrait der lesbischen Königin Christine von Schweden auf sich aufmerksam. Später schrieb sie auch Biografien über andere prominente und einflussreiche Frauen wie die Schriftstellerin Frieda von Bülow und Königin Luise von Preußen.
Sophie Hoechstetter wohnte vornehmlich in Dornburg an der Saale und in Berlin. Nach ihrer Trennung von Toni Schwabe führte sie eine Lebenspartnerschaft mit Carola von Crailsheim (1895–1982), die ebenfalls wie sie Schriftstellerin war. Ihren Lebensabend verbrachte Sophie Hoechstetter zusammen mit ihrer zweiten Lebensgefährtin im Haus eines befreundeten schwedisch-deutschen Künstlerehepaares namens Petersen in der Künstlerkolonie Dachau bei München. Die Verwaltung dieses Hauses hatte Carola von Crailsheim übernommen, nachdem das Ehepaar Petersen 1937 nach Schweden zurückgekehrt war.
Sophie Hoechstetter betrieb in ihrer Heimatstadt Pappenheim ebenfalls eine Versandbuchhandlung, die ihre Lebensgefährtin Carola von Crailsheim ab 1943 weiterführte.
Schriften (Auswahl)
Hoechstetter, Sophie (1908): Christine, Königin von Schweden in ihrer Jugend, in: Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen (Jg. 9), S. 169-190.
Hoechstetter, Sophie [1925]: Lord Byrons Jugendtraum. Novelle. Mit einem Nachwort von Hugo Marcus. Leipzig: Philipp Reclam jun.
Hoechstetter, Sophie (1928): Magnus Hirschfeld 60 Jahre. In: Neue Freundschaft (Jg. 1), Nr. 19, S. 3 [ebenfalls in: Frauenliebe (Jg. 3), Nr. 20, S. 3].
Weiterführende Literatur
Kokula, Ilse (1989): Sophie Höchstetter (1873–1943), in: Ariadne. Almanach des Archivs der deutschen Frauenbewegung, Nr. 14, S. 16-21.
Kokula, Ilse (1993): Sophie Hoechstetter (1873 bis 1943), in: Frau ohne Herz. Feministische Lesbenzeitschrift, S. 14-17, online hier.
Maierhof, Gudrun (1991): „Ich bin kein Mensch, ich bin Dynamit!”. Friedrich Nietzsches Einfluß auf die Frauen der Jahrhundertwende. In: Ariadne. Almanach des Archivs der deutschen Frauenbewegung, Nr. 20, S. 18-20.
Marcus, Hugo (1926): Sophie Hoechstetter, in: Reclams Universum. Moderne illustrierte Wochenschrift (Jg. 42), Nr. 1, S. 253-254.
Marti, Madeleine (o.J.): Eintrag zu Sophie Hoechstetter auf FemBio [online].
Prusakow, Renate (2007): Sophie Hoechstetter. Dichterin & Malerin, in: Historisches Blatt. Heimat- und Geschichtsverein Pappenheim und Ortsteile (online).
Jacobsen, Jo (Schriftstellerin, Psychoanalytikerin) geb. 14.12.1884 (Middelfart, Dänemark) – gest. 18.8.1963 (Kopenhagen, DK)
Zur Biografie


Jo Jacobsen wurde Mutter zweier Kinder, aber im Zuge des großes Medieninteresses an ihr und ihrem Lebenswandel zerbrach die Ehe mit Vagn Jacobsen, so dass diese 1922 geschieden wurde. Jo Jacobsen verließ daraufhin Kopenhagen und zog an den Limfjord nach Nord-Jütland, wo sie sich ihrer schriftstellerischen Karriere widmete.
Jo Jacobsen debütierte literarisch 1924 mit dem Roman Hjertets Køn (Das Geschlecht des Herzens), in dem sie das Milieu schilderte, in dem sie sich als wohlhabende Gattin eines Brauereibesitzers bewegt hatte. In dem Nachfolger Huset Hansen (Das Haus Hansen) beschritt sie 1925 ähnliche Wege, wohingegen ihr Marsvinsjægerne (Die Schweinswaljäger) von 1928 die ärmliche Umgebung beschreibt, in der sie aufgewachsen war. Alle drei Bücher wurden von der dänischen Presse wohlwollend aufgenommen. In einem Buch, das Jo Jacobsen 1949 unter dem Titel En sang på trapperne (Ein Lied auf den Stufen) vorlegte, griff sie christliche Vorstellungen von Schuld und Sühne auf.
Jo Jacobsen engagierte sich ab den frühen 1920er Jahren in der dänischen Frauenbewegung. Sie setzte sich unter anderem in der Organisation „Frivilligt Moderskab“ (Freiwillige Mutterschaft) für eine bessere Sexualerziehung und den Zugang zu Verhütungsmitteln ein, und sie initiierte den Verein „Seksual Oplysnings Forbundet“ (Verein für sexuelle Aufklärung), dessen Vorsitzende sie über viele Jahre war. In der Broschüre Fosterfordrivelsesparagraffen 241 (Der Abtreibungsparagraf 241) und in dem Buch Seksualreform (Sexualreform), die sie 1930 bzw. 1931 vorlegte, beschäftigte sie sich mit sozial- und sexualpolitischen Fragen, und 1944 plädierte sie mit dem Kinderbuch Kærlighetens labyrint (Das Labyrint der Liebe) für die Erweiterung der Rechte unehelich geborener Kinder.
Ihr Buch Seksualreform widmete Jo Jacobsen Wilhelm Reich (1897–1957), in „Bewunderung für die logische Linie, die seine wissenschaftliche Forschung mit seiner sozialen Einstellung verbindet“, und Ende der 1930er Jahre gehörte sie zu dem Kreis der radikalen dänischen Sexualbewegung um die Zeitschrift Sex og Samfund (Sex und Gesellschaft), die Antifaschismus mit Sexualaufklärung im Sinne Reichs verband. Die Zeitschrift fand viele begeisterte Leser und Leserinnen, stieß aber auch auf Widerspruch – und wurde nicht zuletzt von der dänischen Justiz bekämpft, die mehrere Ausgaben unter Verweis auf die dänische Gesetzgebung zur Pornografie beschlagnahmen ließ.
Ebenfalls ab Anfang der 1920er Jahre studierte Jo Jacobsen Sigmund Freud und die Psychoanalyse, und zu diesem Zweck hielt sie sich von 1933 bis 1938 jeweils knapp drei Jahre in Berlin und Wien auf. Zurück in Dänemark, begann sie als Psychoanalytikerin in Kopenhagen zu praktizieren. Wegen ihrer unkonventionellen und provokativen Art wurde sie in der dänischen Presse aber auch oft verspottet. So schrieb sie einmal einen Text, der auf die Melodie des Weihnachtsliedes „Ein Kind geboren zu Bethlehem“ gesungen werden sollte. Er enthält die Zeilen: „Und Papa hat einen Pullermann, / Pullermann, / der mehr noch als nur pullern kann. / Halleluja, halleluja.“
Jo Jacobsen dürfte Magnus Hirschfeld spätestens 1928 auf dem Kopenhagener Kongress der Weltliga für Sexualreform (WLSR) persönlich kennengelernt haben. Auf dem Nachfolgekongress 1929 in London gehörte sie zu den Rednerinnen. In ihrem Beitrag „The Marriage Problem“ beschäftigte sie sich mit der Kameradschaftsehe und forderte mehr Möglichkeiten für Frauen, sich außerhalb der traditionellen Ehe eine eigene wirtschaftliche Grundlage zu schaffen. Sie hob hervor, die Frau könne erst glücklich sein, wenn sie Freiheit in Hinblick auf Sexualität, Kinder, Arbeit und finanzielles Auskommen erreicht habe. Magnus Hirschfeld zog, was Dänemark betrifft, offenbar die Zusammenarbeit mit dem Arzt Jonathan Høegh von Leunbach (1884–1955) der mit Jo Jacobsen vor.
Jo Jacobsen starb am 18. August 1963 in Kopenhagen.
Veröffentlichungen (Auswahl)
Jacobsen, Jo (1930): Fosterfordrivelsesparagraffen § 241. Tvangsfødsel eller Forebyggelse. Kopenhagen: Forlaget „Concordia”.
Jacobsen, Jo (1930): The Marriage Problem. In: Norman Haire (Hrsg.): Sexual Reform Congress. W.L.S.R. World League for Sexual Reform. Proceedings of the Third Congress. London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., S. 58-62.
Weiterführende Literatur
Chakravarty, Dorthe (2016): Jo. Carlsbergfruen, der gik sine egne veje. Et portræt af Jo Jacobsen. København: Gyldendal.
Hilden, Adda (2022): Jacobsen, Jo. Eintrag im Dänischen Frauenbiografischen Lexikon (Dansk Kvindebiografisk Leksikon), online hier.
Junghanns, Inga (Übersetzerin) geb. 9.3.1886 (Kopenhagen, Dänemark) – gest. 25.4.1962 (Kopenhagen, Dänemark)
Zur Biografie


1915 hatte Inga Junghanns über einen gemeinsamen Freund Rainer Maria Rilke (1875–1926) kennengelernt, und schon wenige Monate später begann sie, Rilkes einzigen Roman, Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge (1910), ins Dänische zu übersetzen. In den Jahren bis zu seinem Tod führte sie einen Briefwechsel mit dem Schriftsteller, der einen einzigartigen Einblick in sowohl Rilkes Persönlichkeit als auch in Junghanns‘ Arbeit als Übersetzerin bietet.
Inga Junghanns fühlte sich nach ihrer Rückkehr nach Dänemark nicht mehr zu Hause in ihrem Heimatland. Sie empfand hier eine „geistige Einsamkeit“ und spürte sich mehr und mehr mit Deutschland verbunden. 1923 schrieb sie: „Jede Rückkehr nach Deutschland zeigt mir, wie sehr ich jetzt dorthin gehöre, so wie ich jetzt bin: nicht deutsch, nicht dänisch; nicht Frau, nicht Mann; verheiratet und nicht verheiratet; nicht christlich, nicht jüdisch; nicht alt, nicht jung. Und doch: trotz all dieses Nicht-Seins mitten im Leben, dieser wunderbaren Kiste voller Überraschungen, wenn man erst einmal den Schlüssel zu ihren tiefsten Schätzen gefunden hat.“


Inga Junghanns starb am 25. April 1962 im Alter von 76 Jahren im Kopenhagener Sundby hospital. Sie hatte offenbar keine Verwandten und wurde in aller Stille, ohne dass ein Priester anwesend war, anonym beigesetzt.
Weiterführende Literatur
Anonym (1932): Et socialt Problem, som tiden har skapt. De uvelkomne barn – og alle de arbeidsløse, in: Dagbladet (Oslo), 29.7.1932 (Nr. 174), S. 5.
Herwig, Wolfgang. Hrsg. (1959): Briefwechsel zwischen Rainer Maria Rilke und Inga Junghanns. Wiesbaden: Insel Verlag.
Junghanns, Inga (1932): En Operation. Den skønne Lola Montez er blevet Kvinde efter at have levet hele sit Liv som Mand, in: Social-Demokraten for Randers og Omegn, 7.6.1932, S. 5. [Dieser Artikel wurde zeitgleich auch in mehreren norwegischen Tageszeitungen abgedruckt.]
Schramm, Moritz (o.J.): Inga Junghanns, in: Dansk oversætterleksikon, online hier.
Key, Ellen (Schriftstellerin, Reformpädagogin) geb. 11.12.1849 (Västervik, Schweden) – gest. 25.4.1926 (Ödeshög, Schweden)
Zur Biografie


Ellen Key befasste sich mit dem Geschlechterverhältnis im Allgemeinen und der Frauenfrage im Besonderen, sie suchte nach neuen Lösungen für zentrale Fragen der Erziehung und Bildung und widmete sich sozialen, religiösen und ästhetischen Problemen, mit denen sich die Gesellschaft (nicht nur) im deutschen Kaiserreich konfrontiert sah. Was ihr seinerzeit zum Durchbruch verhalf, war das breite Interesse, das das deutsche Publikum zwischen 1870 und 1914 für Literatur aus Skandinavien hegte.
Weil sie im Christentum ein Hindernis für die „Höherentwicklung“ der Menschheit sah, als Grundlage für eben diese „Höherentwicklung“ aber die Liebe der Frau zu Mann und Kind betrachtete, war Key nicht unumstritten. Aus Teilen der Frauenbewegung ihrer Zeit schallte ihr durchaus Kritik entgegen, insbesondere was ihr Konzept der Mutterschaft betraf. Für Ellen Key war die Vereinbarkeit von Mutterschaft und Erwerbstätigkeit von Frauen kein Anliegen. Sie sah vielmehr im „Heimleben“ der Mütter das Ideal und die Basis für die Erziehung und das Aufwachsen der nachfolgenden Generation.
Doch konnte Key eben auch viele ihrer Zeitgenossen für sich gewinnen. Nachdem etwa Rainer Maria Rilke (1875–1926) Keys Buch Das Jahrhundert des Kindes (Barnets århundrade) in deutscher Übersetzung (1902) gelesen hatte, lobte er die Autorin in einer begeisterten Rezension als „Apostel des Kindes“: Rilke war überzeugt, dass das Zwanzigste Jahrhundert zu den größten gehören werde, „wenn der Traum, den diese seltsame reife und gerechte Frau in seinen ersten Tagen geträumt hat, in seinen letzten in Erfüllung geht.“
Da Rainer Maria Rilke in diesem „Jahrhunderttraum“ Keys selbst eine Rolle spielen wollte, setzte er sich umgehend mit ihr in Verbindung. Das taten auch etliche andere. Die Königliche Bibliothek (Kungliga biblioteket) in Stockholm, in der sich heute der Briefnachlass Ellen Keys befindet, verzeichnet weit über tausend verschiedene Briefpartner Keys, unter ihnen auch Franziska Mann, die Schwester Magnus Hirschfelds.
Franziska Mann und Ellen Key lernten einander im Sommer 1901 kennen. Wann und wo Ellen Key mit Magnus Hirschfeld bekannt wurde, ist nicht belegt. Hirschfeld selbst behauptete später aber mehrfach, Ellen Key sei ihm gut bekannt gewesen. Er zählte sie schlichtweg zu den bedeutendsten Frauen, die er je kennen gelernt habe. 1933 schrieb Hirschfeld, er habe vier Jahrzehnte zuvor, also um 1893, zum ersten Mal von der mit ihm befreundeten Ellen Key die „Lehre” vernommen: „Kinder sind Sache der Gemeinschaft, Ehe ist Privatangelegenheit.” Offenbar spitzte Magnus Hirschfeld hier zu, denn so radikal hatte Ellen Key diese Position zu ihren Lebzeiten ja nie vertreten.
Schriften (Auswahl)
Key, Ellen [1905]: Über Liebe und Ehe. Essays. Autorisierte Übertragung von Francis Maro. Berlin: S. Fischer.
Key, Ellen (1907): Persönlichkeit und Schönheit in ihren gesellschaftlichen und geselligen Wirkungen. Essays. Übertragung von Francis Maro. Berlin: S. Fischer Verlag.
Key, Ellen [1911]: Liebe und Ethik. Berlin: Neues Leben bei Wilhelm Borngraeber.
Key, Ellen (1919): Als ich das erste Mal Franziska Mann traf, in: Franziska Mann. Der Dichterin – Dem Menschen! Zum 9. Juni 1919. Jena: Landhausverlag, S. 3-4.
Weiterführende Literatur
Borgström, Eva (2012): Frida Stéenhoff, Ellen Key och den samkönade kärleken, in: Tidskrift för genusvetenskap, Nr. 3, S. 35-59.
Hirschfeld, Magnus (1933): Die Weltreise eines Sexualforschers. Brugg: Bözberg-Verlag, S. 374.
Hirschfeld, Magnus (1986): Von einst bis jetzt. Geschichte einer homosexuellen Bewegung 1897–1922 [ursprünglich erschienen als Feuilletonserie in der Zeitschrift Die Freundschaft 1922/23]. Hrsg. und mit einem Nachwort versehen von Manfred Herzer und James Steakley. Berlin: Verlag rosa Winkel.
Kinnunen, Tiina (2009): „Werde, die du bist“ – Feminismus und weibliches Lebensgefühl Anfang des 20. Jahrhunderts. Beitrag zum Themenschwerpunkt „Europäische Geschichte – Geschlechtergeschichte“, online auf: Themenportal Europäische Geschichte.
Lindén, Claudia (2018): Ellen Karolina Sofia Key, in: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon.
Mann, Katja (2004): Ellen Key. Ein Leben über die Pädagogik hinaus. Darmstadt: Primus-Verlag.
Maurenbrecher, Hulda (1912): Die neue Auffassung von Mutterpflicht, in: Schreiber, Adele (Hrsg.): Mutterschaft. Ein Sammelwerk für die Probleme des Weibes als Mutter. München: Albert Langen, S. 120-131.
Schurgast, Margarete (1926): Ellen Keys testamente. Ett vackert minne av det sista sammanträffandet, in: Idun (Jg. 39), Nr. 21, S. 516.
Wolfert, Raimund (2017): Annäherungen an Franziska Mann – Schriftstellerin und Briefpartnerin Ellen Keys. In: Mitteilungen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft, Heft 58/59, S. 45-64.
Kollontai, Alexandra (Schriftstellerin, Politikerin) geb. 31.3.1872 (St. Petersburg, Russland) – gest. 9.3.1952 (Moskau, SU)
Zur Biografie


Alexandra Kollontai wurde als Tochter eines ukrainisch-stämmigen Generals namens Domontowitsch und einer finnischen Mutter geboren, verlebte eine unbeschwerte Kindheit in und um St. Petersburg, wurde aber schon früh mit den Klassenunterschieden zwischen ihr und ärmeren Menschen konfrontiert, etwa wenn sie ihre Sommer in Karelien verbrachte bzw. das Leben der arbeitenden Bevölkerung in den russischen Großstädten beobachtete.
Sie heiratete 1893 ihren Cousin Wladimir Kollontai, mit dem zusammen sie einen Sohn bekam, verließ ihren Mann aber bereits fünf Jahre später, um „frei“ zu sein. Sie begann nun ein Studium der Fächer Sozial- und Wirtschaftswissenschaften an der Universität im schweizerischen Zürich. 1908 wurde sie gezwungen, ihr Heimatland Russland zu verlassen und ging ins Exil zunächst nach Deutschland, dann vorübergehend nach Frankreich und ab 1914 nach Schweden und Norwegen. Als sie 1917 nach Russland zurückkehrte, lernte sie den Matrosen Pawel Dybenko (1889–1938) kennen und ging mit ihm die Ehe ein.
Alexandra Kollontai wurde 1917 in den bolschewistischen Rat der Volkskommissare aufgenommen und gehörte als erste Frau dem „revolutionären” Kabinett unter Lenin an. Sie war damit die erste Ministerin der Welt. Als alleinerziehende Mutter und Volkskommissarin setzte sie sich für eine Verbesserung des Mutterschutzes und die kollektive Kindererziehung ein und erreichte das Recht auf Schwangerschaftsabbruch. Mit der Zeit geriet sie jedoch in den Ruf, der parteifeindlichen Opposition anzugehören, was dazu beitrug, dass sie Funktionen im Ausland übernahm. Im Folgenden hatte sie mehrere Posten als Diplomatin und Konsulin in Norwegen (1922–1930) und anschließend in Schweden inne. Zwischenzeitig absolvierte sie einen kurzen Aufenthalt in Mexiko.
Alexandra Kollontai unterließ es ab Mitte der 1920er Jahre, die Politik Josef Stalins öffentlich zu kritisieren, und befürwortete die Verfolgung innerparteilicher Opposition. Zu den stalinistischen „Säuberungen“ in der Sowjetunion ab 1937 schwieg sie. Selbst als ihr zweiter Mann Pawel Dybenko als Trotzkist erschossen wurde, kommentierte sie dies nicht. Von Stalin wurde ihr 1943 der Botschaftertitel verliehen, und bis 1945 war Alexandra Kollontai Botschafterin in Schweden. Sie wurde 1946 und 1947 für den Friedensnobelpreis nominiert, erhielt den prestigeträchtigen Preis jedoch nie.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gab Alexandra Kollontai ihre politische Karriere auf und zog sich aus der Öffentlichkeit zurück. Sie verbrachte die letzten Jahre ihres Lebens in Moskau, fungierte hier hinter den Kulissen aber als Beraterin des sowjetischen Außenministeriums.
Alexandra Kollontai schrieb wissenschaftliche Artikel, Romane, Erzählungen, Pamphlete und unzählige andere Texte, die in hohen Auflagen Verbreitung fanden und gelesen wurden. Vor allem ihre Publikationen aus der Zeit vor 1923 haben nachhaltige Bedeutung für die feministische Theorie und Forschung erlangt. In ihren Schriften trat Alexandra Kollontai für eine freie Sexualität ein und stellte die traditionell untergeordnete Rolle der Frau in Beziehungen in Frage. Vor allem die Möglichkeit, zwischen Liebesbeziehungen und sexuellen Beziehungen zu unterscheiden, wie es Männer tun, war ihr auch in Hinblick auf Frauen wichtig. Alexandra Kollontai bekämpfte die Vorstellung, allein die Kernfamilie ermögliche es einer Frau, Kinder zu bekommen und aufzuziehen. Die von Kollontai favorisierte und idealisierte „Kameradschaftsehe“ war nicht auf Lebenslänglichkeit angelegt und sollte nicht von ökonomischen Interessen geleitet sein. Kollontai plädierte dafür, dass sich Frauen von der „Verantwortung“ für ihre Ehemänner befreien und die dadurch gewonnene Zeit für politische Arbeit, Kunst und den eigenen Beruf nutzen.
Sowohl unter Lenin als auch unter dessen Nachfolger Stalin wurde Alexandra Kollontais Agitation für die Rechte und Entfaltungsmöglichkeiten der Frau, die sie als mindestens ebenso wichtig wie die „Arbeiterfrage“ einschätzte, als kontrovers und potenziell gefährlich empfunden, weil sie geeignet seien, die Interessenskämpfe von männlichen und weiblichen Arbeitenden zu spalten und damit zu schwächen.
Ob sich Magnus Hirschfeld und Alexandra Kollontai je begegnet sind, ist ungeklärt. Hirschfeld schätzte Kollontai als „bewundernswürdige Dichterin“, nachdem er 1925 ihre Novellensammlung Wege der Liebe gelesen hatte, in der sie die „Kameradschaftsehe“ als neue heterosexuelle Beziehungsform schilderte. Kurt Tucholsky (1890–1935) urteilte über diese Sammlung indes schon 1926 in der Weltbühne: „Frau Kollontai ist sicherlich eine gute Politikerin. Bücher schreiben kann sie nicht.” Insofern als Magnus Hirschfeld im Bilderteil seiner Geschlechtskunde 1930 ein signiertes Foto Alexandra Kollontais veröffentlichte, das den Zusatz „Oslo 1929“ trägt, kann davon ausgegangen werden, dass die zwei zumindest vorübergehend in einem direkten brieflichen Kontakt miteinander standen.
Schriften (Auswahl)
Kollontay, Alexandra (1925): Wege der Liebe. Berlin: Malik-Verlag.
Kollontay, Alexandra (1932): Familie und Kommunismus. In: Atlantis (Jg. 4), Nr. 12, S. 747-748.
Kollontai, Alexandra (1970): Autobiographie einer sexuell emanzipierten Kommunistin. Hrsg. und mit einem Nachwort von Iring Fetscher. München: Rogner & Bernhard.
Kollontai, Alexandra (1982): Ich habe viele Leben gelebt. Autobiographische Aufzeichnungen. Berlin/DDR: Dietz.
Weiterführende Literatur
Gretter, Susanne (o.J.): Alexandra Kollontai, auf: Fembio Frauen.Biographieforschung.
Leppänen, Katarina (2018): Aleksandra Mikhajlova Kollontaj, in: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon.
Wrobel, Ignaz [d i. Kurt Tucholsky] (1926): Wege der Liebe [Rezension], in: Die Weltbühne, 10.8.1926 (Nr. 32), S. 230.
Kollwitz, Käthe (Grafikerin, Bildhauerin) geb. 8.7.1867 (Königsberg, heute Kaliningrad, RUS) – gest. 22.4.1945 (Moritzburg)
Zur Biografie


Im Juni 1891 heiratete Käthe Schmidt ihren langjährigen Verlobten, den Arzt Karl Kollwitz (1863–1940), mit dem sie nach Berlin zog. Das Ehepaar ließ sich in der damaligen Weißenburger Straße (heute Kollwitzstraße) im Ortsteil Prenzlauer Berg nieder, wo Karl Kollwitz fortan eine Allgemeinpraxis als Armenarzt betrieb. In Berlin wurde Käthe Kollwitz Mutter zweier Söhne, die 1892 und 1896 geboren wurden.
Karl Kollwitz engagierte sich in der Deutschen Liga für Menschenrechte und wurde nach 1919 als Stadtverordneter der SPD und als Mitglied des Internationalen Sozialistischen Kampfbundes tätig. Seine Frau Käthe Kollwitz bzw. Schmidt hatte sich schon Jahre vor ihrer Eheschließung als Grafikerin und Malerin mit der sozialen Frage und den Lebensumständen benachteiligter Menschen und Angehöriger der Arbeiterklasse beschäftigt. Als ihr zweitgeborener Sohn Peter als Soldat 1914 in Belgien fiel, kam Käthe Kollwitz in enge Berührung mit dem Pazifismus. Sie war Mitglied im Deutschen Künstlerbund und der Berliner Secession und arbeitete für die Internationale Arbeiterhilfe (IAH).
Obwohl Käthe Kollwitz nie einer Partei angehörte, unterstützte sie einen Aufruf des Internationalen Sozialistischen Kampfbundes (ISK) zur Zusammenarbeit von KPD und SPD. 1933 wurde sie zum Austritt aus der Preußischen Akademie der Künste gezwungen, und drei Jahre später wurden ihre Werke von einer Jubiläumsausstellung Berliner Bildhauer entfernt, was einem offiziellen Ausstellungsverbot gleichkam. 1937 wurden mehrere Werke Käthe Kollwitz‘ als „entartete Kunst“ beschlagnahmt und zwangsveräußert.
Gleichwohl konnte Käthe Kollwitz selbst relativ unbehelligt weiter schaffend tätig sein. 1943 floh sie vor den drohenden Bombenangriffen aus Berlin nach Nordhausen (Thüringen), wobei zahlreiche ihrer Werke in ihrer Berliner Wohnung durch Bombentreffer vernichtet wurden. Im Sommer 1944 zog Käthe Kollwitz nach Moritzburg bei Dresden um, wo sie am 22. April 1945, nur wenige Tage vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs, starb.
Magnus Hirschfeld und Käthe Kollwitz dürften einander mehrfach begegnet sein. Kollwitz gehörte 1920 neben Lou Andreas-Salome Louise Dumont, Gertrud Eysoldt, Grete Meisel-Hess, Adele Schreiber und Helene Stöcker zu den sieben erstunterzeichnenden Frauen der Petition gegen den § 175 RStGB, der mann-männliche Sexualkontakte unter Strafe stellte. Am 2. Februar 1924 nahm sie neben Gertrud Eysoldt und etlichen anderen an einer Feierlichkeit im Institut für Sexualwissenschaft teil.
Ilse Kokula hat herausgestellt, dass Käthe Kollwitz heute zwar den meisten als „treusorgende Ehefrau und Mutter“ bekannt ist, dass sie aber gleichwohl zu den Sympathisantinnen eines Kommunikationsnetzwerkes lesbischer Künstlerinnen zur Zeit der Weimarer Republik gehörte. Käthe Kollwitz schrieb einmal über sich selbst: „Rückblickend auf mein Leben muß ich noch dazufügen, daß – wenn auch die Hinneigung zum männlichen Geschlecht die vorherrschende war – ich doch wiederholt auch eine Hinneigung zu meinem eigenen Geschlecht empfunden habe, die ich meist erst später richtig zu deuten verstand. Ich glaube, daß Bisexualität für künstlerisches Tun fast notwendig Grundlage ist, daß jedenfalls der Einschlag M. in mir meiner Arbeit förderlich war.“ Mit „Einschlag M.” meinte sie offenbar ihre eigenen männlichen Anteile.
Weiterführende Literatur (Auswahl)
Anonym (1924): Eine neue wissenschaftliche Stiftung in Berlin [Kurzmeldung unter „Kunst / Wissen / Leben“], in: Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung, 6.2.1924 (Jg. 82, Nr. 31), S. 2.
Hirschfeld, Magnus (1921): Aus der Bewegung, in: Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen (Jg. 20), S. 107-142, hier S. 115.
Kokula, Ilse (1994): Lesbisch leben von Weimar bis zur Nachkriegszeit (Nachwort), in: Meyer, Adele. Hrsg. Lila Nächte. Die Damenklubs im Berlin der Zwanziger Jahre. Berlin: Edition Lit.europe, S. 101-123. hier S. 105.
Kollwitz, Käthe (1981): Ich will wirken in dieser Zeit. Auswahl aus den Tagebüchern und Briefen, in: Graphiken, Zeichnungen und Plastik. Hgg. von Hans Kollwitz. Frankfurt, Berlin, Wien: Ullstein.
Kowalewskaja, Sofja (Prof. Dr. math., Mathematikerin) geb. 3.1.1850 (Moskau, RUS) – gest. 29.1.1891 (Stockholm, Schweden)
Zur Biografie


Schon früh erlebte sich Sofja Kowalewksaja als ungeliebtes Kind, die Eltern hatten sich einen Sohn gewünscht. Sofja Kowalewskaja wollte zunächst Schriftstellerin werden, begeisterte sich aber auch sehr für die Mathematik, und sie erhielt Privatunterricht bei einem Freund der Eltern, der Professor an der russischen Marineakademie in St. Petersburg war. Frauen war damals die Ausbildung an russischen Hochschulen noch weitgehend verschlossen, und um ihre Ausbildung voranzutreiben, ging Sofja Kowalewskaja im Alter von 18 Jahren eine Scheinehe ein, um mit der Zustimmung ihres Mannes ein Auslandsstudium in Wien aufnehmen zu können. 1869 zog Sofja Kowalewskaja mit ihrem Mann nach Heidelberg, wo sie sich vornehmlich mit elliptischen Funktionen beschäftigte, wo sie sich aber auch maßgeblich für das Recht von Frauen auf eine Hochschulbildung stark machte. 1874 erhielt sie als erste Russin einen Doktortitel in Chemie.
Auch nachdem Sofja Kowalewskaja nach Berlin umgezogen war, durfte sie als Frau an regulären Universitätsvorlesungen nicht teilnehmen, und sie nahm weiterhin Privatunterricht, diesmal bei dem Mathematiker Karl Weierstraß (1815–1897). Dieser beantragte 1874 für Sonja Kowalewskaja die Promotion in Mathematik an der Universität in Göttingen, die ihr „in absentia“, das heißt ohne mündliche Prüfung, und allein auf Grundlage ihrer Veröffentlichungen erteilt wurde.
Da Sofja Kowalewskaja trotz Empfehlungsschreiben keine Stelle an einer deutschen Universität erhielt, kehrte sie zusammen mit ihrem Mann nach Russland zurück, wo ihre ausländischen Abschlüsse nicht anerkannt wurden. Sie arbeitete vorübergehend als Theaterkritikerin und nahm verschiedene Schreibarbeiten an, um Geld zu verdienen. Sofja Kowalewskaja wurde 1878 Mutter einer Tochter.
Als 1881 Zar Alexander ermordet wurde, entschied sich Sofja Kowaleskaja, zusammen mit ihrer Tochter das unruhige Russland zu verlassen, um eine gewisse Zeit in Deutschland und Frankreich zu verbringen. Ihr Mann blieb in Russland zurück. Da er in seiner Eigenschaft als Berater eines Ölkonzerns wohl unwissentlich in illegale Geschäfte verwickelt wurde, wegen dieser Umstände aber vor Gericht gestellt werden sollte, nahm er sich 1883 das Leben. Dies bedeutete einen Schock für Sofja Kowalewskaja, die sich nach wie vor in West-Europa aufhielt.
Sofja Kowalewskaja wurde im Herbst 1883 als Dozentin an die Universität in Stockholm berufen, und hier wurde sie zur ersten Professorin Schwedens ernannt. Die zunächst befristete Stelle wurde 1889 in eine Professur auf Lebenszeit umgewandelt. Obwohl sie nun zum ersten Mal in ihrem Leben ein regelmäßiges finanzielles Auskommen hatte und gesellschaftliche Anerkennung erfuhr, fühlte sich Sofja Kowalewskaja in Schweden aber nie wirklich heimisch.
Sofja Kowalewskaja gilt als die bedeutendste Mathematikerin des 19. Jahrhunderts. In ihren letzten Lebensjahren veröffentlichte sie auch mehrere Kurzgeschichten und Theaterstücke sowie einen autobiografischen Roman. Während einer Auslandsreise im Winter 1890/91 zog sich Sofja Kowalewskaja eine schwere Lungenentzündung zu. Sie starb am 29. Februar 1891 in Stockholm.
Ihre Freundin, die schwedische Schriftstellerin Anne Charlotte Leffler (1849–1892), schrieb eine Biografie über Sofja Kowalewskaja, die 1892 veröffentlicht wurde und in mehrere Sprachen übersetzt wurde. 1948 brachte die Russische Akademie der Wissenschaften alle wissenschaftlichen Arbeiten Sofja Kowalewskajas in der Reihe „Klassiker der Wissenschaft“ heraus, und seit 1992 wird von derselben Akademie für herausragende Leistungen auf dem Gebiet der Mathematik der Kowalewskaja-Preis verliehen.
Magnus Hirschfeld sah in Sofia Kowalewskaja vor allem ein Paradebeispiel dafür, dass nicht alle Frauen „Margarethen“ seien, so wenig wie alle Männer „Fauste“. Für ihn vereinigten sich in jedem Individuum männliche wie weibliche Anteile menschlicher Eigenschaften, wodurch jeder Mensch in einem ganz eigenen Mischungsverhältnis eine „Zwischenstufe“ sei. Hirschfeld hielt fest, Sofja Kowalewskaja überrage „den Mann“ an Abstraktheit und Tiefe „hoch“.
Weiterführende Literatur
Herzer, Manfred (2017): Magnus Hirschfeld und seine Zeit. Berlin/Boston: De Gruyter, S. 53, 94.
Hibner-Koblitz, Ann (1993): A Convergence of Lives. Sofia Kovalevskaia – Scientist, Writer, Revolutionary (2. Ausgabe). New Brunswick: Rutgers University Press.
Hirschfeld, Magnus (1896): Sappho und Sokrates oder Wie erklärt sich die Liebe der Männer und Frauen zu Personen des eigenen Geschlechts? Von Dr. med. Th. Ramien. Leipzig: Max Spohr, S. 27.
Hirschfeld, Magnus (1899): Die objektive Diagnose der Homosexualität. In: Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen 1, S. 4-35, hier S. 21.
Karlsson, Linus (2018): Sophie (Sonja) Vasiljevna Kovalevsky, in Svenskt kvinnobiografiskt lexikon.
Leffler, Anna Charlotte (1894): Sonja Kovalevsky, was ich mit ihr zusammen erlebt habe und was sie mir über sich selbst mitgeteilt hat. Leipzig: Reclam (Volltext online hier).
Rauch, Judith (1993): Sonja Kowalewskaja. Das geniale Scheusal, in: Emma 3/1993.
Schroeder, Hiltrud (1991): Sofia Kowalewskaja, auf Fembio. Frauen.Biographieforschung.
Kraus-Fessel, Meta (Journalistin, Sozialexpertin) geb. 6.8.1884 (Przytullen, heute Przytuły, PL) – gest. 21.11.1940 (New York, USA)
Zur Biografie


1918 kehrte Meta Kraus-Fessel ohne ihren Mann nach Berlin zurück, wo sie ihre soziale Arbeit fortsetzte. Im Zuge ihres Engagements für Menschen in Arbeitervierteln wie dem Wedding, Moabit und Prenzlauer Berg lernte sie u.a. die Malerin Käthe Kollwitz kennen, die 1919 als erste Frau in die Preußische Akademie der Künste aufgenommen worden war.
Meta Kraus-Fessel wurde am 1. Oktober 1919 als erste Frau Beamtin im Preußischen Ministerium für Volkswohlfahrt, hier war sie zunächst als Referentin, später auch als Regierungsrätin tätig. Inhaltlich war sie mit der Kleinkinderfürsorge und der Fürsorge für die „sittlich gefährdete weibliche Jugend“ betraut. Meta Kraus-Fessel trat aus bislang unbekannten Gründen schon 1924 in den einstweiligen Ruhestand, arbeitete ab dieser Zeit aber immer wieder mit Magnus Hirschfeld zusammen.
So schrieb sie etwa für Hirschfelds Sittengeschichte der Nachkriegszeit (1931) einen Beitrag über „Frauenarbeit und Frauenemanzipation in der Nachkriegszeit ab 1919“, in dem sie die Berufstätigkeit der Frauen als unabdingbare Voraussetzung für deren Emanzipation hervorhob: „Der Weg der Frau ins Erwerbsleben, zur wirtschaftlichen und persönlichen Unabhängigkeit ist der Anfang des Weges zu sich selbst, zum tiefsten Grunde ihres Wesens, nicht mehr, aber auch nicht weniger“, hielt sie hier fest. Unter Auswertung statistischer Daten schrieb Meta Kraus-Fessel, es gebe in Deutschland rund 155 Prozent mehr erwerbstätige Frauen als „Nur-Ehefrauen, woraus die zunehmende Bedeutungslosigkeit der Ehe als wirtschaftliche Versorgung der weiblichen Bevölkerung klar wird.“ 1930 nahm Meta Kraus-Fessel auch an dem Kongress der Weltliga für Sexualreform (WLSR) in Wien teil.
Politisch engagierte sich Meta Kraus-Fessel zunächst in der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), trat aber bereits 1919 der Kommunistischen Partei (KPD) bei. Sie betätigte sich innerhalb der Internationalen Arbeiterhilfe (IAH) und war 1924 Mitbegründerin der Roten Hilfe Deutschlands (RHD). Deren Ziel war es, den nach dem Spartakusaufstand 1919 inhaftierten Revolutionären juristischen Schutz bei Gerichtsverhandlungen zu bieten und deren Angehörige emotional und finanziell zu unterstützen. Die Rote Hilfe betrieb in Deutschland auch Kinderheime, so etwa den Barkenhoff des Malers und Architekten Heinrich Vogeler (1872–1942) in Worpswede.
Als der Barkenhoff in finanzielle Schwierigkeiten geriet und die deutschen Behörden immer wieder nach neuen Gründen suchten, das Kinderheim zu kriminalisieren, wurde 1926 ein Kuratorium zum Erhalt der Einrichtung gegründet, dem neben Meta Kraus-Fessel, Käthe Kollwitz und anderen Prominenten auch Magnus Hirschfeld angehörte.
Angesichts der Entwicklungen in der Sowjetunion wandte sich Meta Kraus-Fessel von der KPD ab und schloss sich anarchistischen Kreisen an. Nach der Ermordung des Anarchisten Erich Mühsam (1878–1934) im Konzentrationslager Oranienburg, den Meta Kraus-Fessel zeitweise bei sich versteckt gehalten hatte, um ihn vor der Verhaftung durch die Nationalsozialisten zu schützen, kümmerte sie sich um dessen Witwe Zenzl Mühsam (1884–1962), von der sie sich allerdings bald entfremdete.
1933 entzog sich Meta Kraus-Fessel einer drohenden Verhaftung durch die Gestapo, indem sie nach Amsterdam flüchtete. Von hier zog sie bald nach Österreich und 1938 von dort weiter nach Paris, um sich schließlich in den USA niederzulassen. Die US-amerikanische Anarchistin Emma Goldman hatte ihr angeboten, sie könne einen Lehrstuhl an der Universität im kanadischen Victoria übernehmen. Doch dazu kam es nicht mehr. Meta Kraus-Fessel war an Darmkrebs erkrankt und musste sich im Mai 1940 einer schweren Operation unterziehen. Mit der Unterstützung Emma Goldmans konnte sie, unheilbar krank, das Krankenhaus verlassen. Am 21. November 1940 schied sie in New York durch Selbstmord aus dem Leben.
Schriften (Auswahl)
Kraus-Fessel, Meta und Siegfried Kraus (1919): Die Organisation und die Tätigkeit des Städt. Fürsorgeamtes für Kriegshinterbliebene in Frankfurt. Frankfurt am Main: H. L. Brönner.
Kraus-Fessel, Meta (1923): Fürsorgewesen und Arbeiterklasse. In: Sozialistische Monatshefte (Jg. 29), Nr. 11, S. 671-675 (online hier).
Kraus-Fessel, Meta (1923): Krisis in den Beratungen des Ges.-Entw. zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten. In: Soziale Praxis. Centralblatt für Sozialpolitik (Jg. 32), S. 158.
Kraus-Fessel, Meta (1925): Schwangeren-, Mütter- und Kinderschutz als Aufgabe der Justizreform. In: Die neue Generation (Jg. 18), S. 68-78.
Kraus-Fessel, Meta (1926): Strafe auf Schwangerschaftsunterbrechung. In: Die neue Generation (Jg. 22), S. 54.
Kraus-Fessel, Meta (1927): Frauen im Polizeidienst. In: Die neue Generation (Jg. 23), S. 46.
Kraus-Fessel, Meta (1927): Polizei-Terror gegen Kind und Kunst. Dokumente zur Geschichte der sozialen Republik Deutschlands. Berlin: Mopr.
Kraus-Fessel, Meta (1929): Schule und Aufklärung. In: Die Ehe (Jg. 4), Nr. 3, S. 76-78.
Kraus-Fessel, Meta (1931, Reprint 1966): Frauenarbeit und Frauenemanzipation in der Nachkriegszeit ab 1919. In: Magnus Hirschfeld (Hrsg.): Zwischen zwei Katastrophen (früher: Sittengeschichte der Nachkriegszeit). Hanau/Main: Verlag Karl Schustek, S. 165–196.
Weiterführende Literatur
Bergemann, Hans; Dose, Ralf; Keilson-Lauritz, Marita. Hrsg. (2019): Magnus Hirschfelds Exil-Gästebuch. Unter Mitarbeit von Kevin Dubout. Leipzig, Berlin: Hentrich & Hentrich, S. 215.
Eckhardt, Hanna: Kraus-Fessel, Meta. In: Frankfurter Personenlexikon.
Helm, Inge (2008): Gelebte Emanzipation. Mutige Frauen zwischen Küche, Mutterkreuz und „Roter Hilfe”. Berlin: Karin Kramer Verlag.
Kühl, Richard (2022): Der große Krieg der Triebe. Die deutsche Sexualwissenschaft und der Erste Weltkrieg. Bielefeld: transcript Verlag, S. 429.
Müller, Reinhard (2012): Meta Kraus-Fessel, in: Archiv für die Geschichte der Soziologie in Österreich.
Müller, Reinhard (2001): Menschenfalle Moskau. Exil und stalinistische Verfolgung. Hamburg: Hamburger Edition.
Schmidt, Birgit [2008]: Schönere Hüte. Frauen zwischen Feminismus, Revolution und Verfolgung. Berlin: Karin Kramer Verlag.
Krische, Maria (Lehrerin, Sexualreformerin) geb. 17.4.1880 (Köln) – gest. 3.7.1945 (Neustrelitz)
Zur Biografie


Maria Reineke besuchte ab 1897 die Lehrerinnen-Bildungsanstalt in Köln, um sich zur Volkschullehrerin ausbilden zu lassen. Lehrerin war indes nie ihr Traumberuf gewesen. Nach dem Examen unterrichtete sie ab 1900 an einer Privattöchterschule in Driesen (heute Drezdenko, Polen) in der Neumark.
1904 ging Maria Reineke mit dem Göttinger Soziologen und Naturwissenschaftler Paul Krische (1878–1956) die Ehe ein. Sie wurde Mutter zweier Söhne. In einer außerehelichen Verbindung wurde Paul Krische später Vater eines dritten Sohnes.
Nach der Eheschließung zog das Ehepaar Krische zunächst nach Köslin (heute Koszalin, Polen) in Pommern, ließ sich jedoch 1906 in Berlin nieder, wo Paul Krische als Bibliothekar tätig wurde. Maria Krische hatte als junge Mutter zunächst ihre Berufstätigkeit unterbrochen und kehrte erst 1914 in ihren Beruf als Lehrerin zurück.
Maria Krische engagierte sich in der Freireligiösen Gemeinde und stellte 1917 beim preußischen Schulministerium einen Antrag, nach dem für konfessionell ungebundene Kinder nicht der übliche Religionsunterricht, sondern ein überreligiöser Moralunterricht („Lebenskunde“) angeboten werden solle. Ihrem Antrag wurde nach dem Ersten Weltkrieg stattgegeben.
Zur Zeit des Ersten Weltkrieges nahm Maria Krische Kontakte zur Sexualreformbewegung auf, und Magnus Hirschfeld dürfte sie 1915 auf einer Versammlung des Monistenbundes kennengelernt haben. Mit ihm verband sie später eine enge Freundschaft. 1920 wurde Maria Krische Mitglied der Ärztlichen Gesellschaft für Sexualwissenschaft und Eugenik, und zusammen mit ihrem Mann Paul Krische gehörte sie später dem Arbeitsausschuss der Weltliga für Sexualreform (WLSR) an, deren Kopenhagener Kongress sie zusammen mit dem dänischen Sexologen Jonathan Høegh von Leunbach (1884–1955) und dem Ehepaar Walther und Hertha Riese aus Frankfurt am Main vorbereitete. Zusammen mit Magnus Hirschfeld gab Maria Krische 1929/30 ebenfalls die populärwissenschaftliche Monatsschrift Die Aufklärung heraus.
Maria und Paul Krische standen der SPD nah, sie engagierten sich im Bund für Mutterschutz Helene Stöckers und wurden in der Freikörperkulturbewegung aktiv. Nach der Machtübergabe an die Nationalsozialisten 1933 zog sich das Ehepaar aus der Öffentlichkeit zurück und stellte seine politische Tätigkeit weitgehend ein. Ein ursprünglich auf fünf Bände angelegtes Werk von Paul und Maria Krische, Der Schicksalsweg der Frau, kam deshalb über den 1927 erschienenen Band zur Mutterrechtsgesellschaft nicht hinaus. Im Sommer 1934 besuchte das Ehepaar Krische Magnus Hirschfeld in seinem französischen Exil vermutlich ein letztes Mal.
Maria Krische erkrankte um 1944 an Anämie und Ruhr und verstarb am 3. Juli 1945 im Krankenhaus von Neustrelitz. Sie wurde auf dem dortigen Parkfriedhof an der Glambecker Straße (heute Hohenzieritzer Straße) beigesetzt. In Anlehnung an das bekannte Lied von Carl Bohm (1844–1920) ließ Paul Krische 1946 auf dem Grabmal seiner Frau die Inschrift „Still wie die Nacht und tief wie das Meer soll unsere Liebe sein” anbringen.
Werke (Auswahl)
Krische, Maria (1921): Die Sexuelle Frage in der Erziehung. Berlin: A. Hoffmann.
Krische, Maria (1925): Religion und Geschlechtlichkeit. Leipzig: Verlagsanstalt für proletarische Freidenker.
Krische, Maria [1932]: Das Freidenkertum und die Frauen. Berlin: Deutscher Freidenker-Verband.
Krische, Paul (1927): Das Rätsel der Mutterrechtsgesellschaft. Eine Studie über die Frühepoche der Leistung und Stellung des Weibes. Unter Mitarbeit von Maria Krische. München: Georg Müller.
Weiterführende Literatur
Bergemann, Hans; Dose, Ralf; Keilson-Lauritz, Marita. Hrsg. (2019): Magnus Hirschfelds Exil-Gästebuch. Unter Mitarbeit von Kevin Dubout. Leipzig, Berlin: Hentrich & Hentrich, S. 215.
Dose, Ralf (1991): Aufklärungen über die „Aufklärung“. Ein Werkstattbericht. In: Mitteilungen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft Nr. 15, S. 31-43.
Kühl, Richard (2009): Maria Krische (1880–1945) und Paul Krische (1878–1956) in: Sigusch, Volkmar und Günter Grau (Hrsg.): Personenlexikon der Sexualforschung. Frankfurt am Main, New York: Campus, S. 392-397.
Reinert, Kirsten (2000): Frauen und Sexualreform 1897–1933. Herbolzheim: Centaurus.
Tagebücher Paul Krisches
Seit 2013 besitzt die Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft zahlreiche Tage-, Jahres- und Erinnerungsbücher aus dem Nachlass von Paul und Maria Krische. Die von Paul Krische handschriftlich geführten Tagebücher umfassen die Jahre 1930 bis 1940, die Sammelalben stammen aus den Jahren 1915 bis 1953. Zusätzlich gehören Unterlagen zur Familiengeschichte und vier Kästen mit Fotografien zu dem Konvolut. Näheres hier.
Kwasnik, Erika (Fremdsprachenkorrespondentin) geb. 1912 (Berlin) – gest. nach 1985 (Ort nicht belegt)
Zur Biografie


Erika Kwasnik schrieb später: „Ich habe Hirschfelds Heim in Erinnerung als etwas Kostbares, etwas Warmes, wo man hübsche Dinge fand, wo es, kurz gesagt, eine schöne Atmosphäre gab.“ Seit etwa 1917 hob sie zum Beleg eine Fotografie auf, die Magnus Hirschfeld mit vielen Freund*innen und Hausangestellten sowie deren Angehörigen vor einem Weihnachtsbaum zeigt. Zu sehen sind auf dem Foto neben Hirschfeld fast nur Frauen und Kinder, weil die meisten Männer „Kriegsdienst“ leisten mussten. Erika Kwasnik schenkte das Bild der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft. Sie selbst steht auf diesem Bild links neben Hirschfeld als das Kleinste der Kinder.
Erika Kwasnik erinnerte sich, dass sie Magnus Hirschfeld stets mit „Onkel Hirschfeld“ anredete, und sie bescheinigte ihm noch Jahrzehnte später große Freundlichkeit und ein großes Einfühlungsvermögen: „Er war ein strahlender Mensch, sein frohes Lachen klang durch die Wohnung, besonders, wenn man eine schnelle Antwort fand.“
Wohl das letzte Mal traf Erika Kwasnik Magnus Hirschfeld im Alter von etwa 16 Jahren. Das war am 11. August 1928, dem deutschen „Verfassungstag“, in der Berliner Krolloper. Wenige Monate zuvor war Magnus Hirschfeld als Sachverständiger in dem „Steglitzer Schülermordprozess“ aufgetreten, der den Prozess auslösende Vorfall hatte in ganz Deutschland und auch in der internationalen Presse großes öffentliches Aufsehen erregt und zu heftigen Debatten über den angeblichen sittlichen Verfall der Jugend in der Weimarer Republik geführt. Unter den Schulkameraden Erika Kwasniks nahm um diese Zeit die antisemitische Hetze gegen Hirschfeld zu. Erika Kwasnik erinnerte sich: „Einige Mädchen in meiner Klasse, die zu den faulsten gehörten, waren die lautesten, sie redeten abfällig über Magnus Hirschfeld als ‚der schwule Jude‘. Niemals hätte jemand in unserer Familie ihn als homosexuell gekennzeichnet […]. Ich wurde wütend, kam in Streit mit diesen Mädchen. Die Kameraden, die zu mir hielten, versuchten, mich zur Vernunft zu bringen. Ich duldete kein abwertendes Wort über Magnus Hirschfeld.“
Erika Kwasnik zog später nach Dänemark, wo sie 1985 noch lebte. Belegt ist, dass sie zwischen 1953 und 1969 als Fremdsprachenkorrespondentin im Kopenhagener Tuborgvej 249 wohnte. Da war sie nach wie vor unverheiratet. Erika Kwasniks genaues Sterbedatum und ihr Sterbeort haben sich noch nicht ermitteln lassen. Ebenso ist immer noch wenig über Erika Kwasniks Familienhintergrund bekannt. Ihr Vater war offenbar der Gewerkschaftsfunktionär Walter Kwasnik, der ab etwa 1924 Schriftleiter des Deutschen Landarbeiter-Verbandes (LVB) war.
Weiterführende Literatur
Hertoft, Preben und Teit Ritzau (1984): Paradiset er ikke til salg. Trangen til at være begge køn. Kopenhagen: Lindhardt og Ringhof.
Kwasnik, Erika (1985): Bei „Onkel Hirschfeld”. In: Mitteilungen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft Nr. 5, S. 29-32.
Kwasnik, Walter (1931): Deutscher Landarbeiter-Verband, in: Heyde, Ludwig (Hrsg.): Internationales Handwörterbuch des Gewerkschaftswesens. Berlin: Verlag Werk und Wirtschaft, S. 372-373.
Lange, Mathilde (Schriftstellerin)
Zur Biografie
Über Mathilde Lange ist kaum etwas bekannt. Als Joseph Aschkinasy (1880–?) am 18. Februar 1907 im Altstädter Hof, dem Versammlungslokal des Wissenschaftlich-humanitären Komitees (WhK), über „Das Problem der Geschlechter. Umriss einer Philosophie des Sexuellen“ sprach, wurde der Abend durch Gedichtvorträge von „Fräulein“ S. Birk und Mathilde Lange ausgefüllt. Joseph Aschkinasy war russischer Staatsbürger und Jude, stammte gebürtig aus Odessa und studierte seit 1905 Philosophie an der Universität in Leipzig. Über S. Birk liegen keine weiteren Angaben vor, der Bezeichnung „Fräulein“ zufolge war sie ledig. Mathilde Lange hingegen war verheiratet, ihr Geburtsname lautete von Lüderitz. Sie scheint schon etwas älter gewesen zu sein, da sie bereits 1882 unter ihrem Ehenamen einen Gedichtband mit dem Titel „Immergrün“ veröffentlicht hatte. Dieses Buch befand sich auch in der frühen WhK-Bibliothek, es wurde im Katalog 1906 unter der Notation „Lange, Tilde: Immergrün (Gedichte)“ geführt. Heute scheint von diesem Buch kein Exemplar mehr erhalten zu sein.
Gänzlich unbekannt ist auch, ob, und wenn ja, in welcher Beziehung Mathilde Lange zu dem Breslauer und später Berliner Spielleiter und Theaterschriftsteller Oskar Lange-Lüderitz (?–1935) stand, der nach 1920 das Kindertheater „Märchenbühne Lange-Lüderitz“ gründete und fortan leitete.
Weiterführende Literatur
Anonym [1906]: Katalog der Bibliothek des Wissenschaftlich-Humanitären Komités. Charlottenburg: Fänger & Heimann [Drucker], S. 13.
Hergemöller, Bernd-Ulrich: Lange-Lüderitz, Oscar, in ders. (Hrsg.): Mann für Mann. Biographisches Lexikon zur Geschichte von Freundesliebe und mannmännlicher Sexualität im deutschen Sprachraum (Bd. 1: A–Ras). Berlin/Münster: Lit-Verlag, S. 722.
Monatsbericht des Wissenschaftlich-humanitären Komitees, 1.3.1907 (Jg. 6, Nr. 3), S. 43.
Pataky, Sophie (2014): Lexikon deutscher Frauen der Feder. Vollständiger Neusatz beider Bände in einem Buch. Vollst. Neuausgabe, hrgg. von Karl-Maria Guth [ursprüngl. 1898]. Berlin: Hofenberg, S. 344 (im Original online hier).
Lasker-Schüler, Else (Schriftstellerin) geb. 11.2.1869 (Elberfeld) – gest. 22.1.1945 (Jerusalem, Israel)
Zur Biografie


1894 heiratete Else Schüler den jüdischen Arzt Dr. Jonathan Berthold Lasker (1860–1928), mit dem sie wenig später nach Berlin zog. 1899 später wurde sie hier Mutter ihres einzigen Kindes, Paul Lasker-Schüler (1899–1927), doch schon kurz nach der Geburt ihres Sohnes trennte sich Else Lasker-Schüler von ihrem Mann, der auch nicht Vater des Jungen war.
In Berlin studierte Else Lasker-Schüler zunächst Malerei, aber sie veröffentlichte auch schon früh erste Gedichte. Der Schriftsteller Peter Hille (1854–1904), mit dem sie sich anfreundete, führte sie um 1900 in die Künstlerkolonie „Neue Gemeinschaft“ ein, in deren Umfeld sie ihren zweiten Mann, den neun Jahre jüngeren Schriftsteller und Musiker Georg Lewin (1878–1941), kennen lernte. Er erhielt von ihr den Namen „Herwarth Walden“, unter dem er bekannt werden sollte. Doch auch die Ehe mit „Herwarth Walden“ scheiterte nach einigen Jahren.
Else Lasker-Schüler veröffentlichte Gedichte in Zeitschriften wie Der Sturm und Die Fackel, und sie gab eine Reihe von Lyrikbänden, Prosawerken und Dramen heraus. Sie war mit Dichtern und Künstlern wie George Grosz, Kurt Hiller, Johannes Holzmann, Oskar Kokoschka, Erich Mühsam, Georg Trakl und Gottfried Benn befreundet und gehörte mit ihrem bizarren Auftreten zum Kern der intellektuellen und künstlerischen Berliner Caféhaus-Szene. Mit Benn ging sie 1912 eine Beziehung ein, und er sollte sie noch 1952 als „die größte Lyrikerin, die Deutschland je hatte“ nennen. Auch wenn sich Benn bereits 1933 dem nationalsozialistischen Staat andiente, blieben die zwei bis an Else Lasker-Schülers Lebensende Freunde.
Else Lasker-Schüler lehnte die traditionelle Frauenrolle in der bürgerlichen Gesellschaft ab und brachte dies unter anderem durch ihren Haarschnitt und ungewöhnliche Kleidung zum Ausdruck. So trug sie gern weite Hosen und bunte Gewänder mit klimpernden Ketten und Fußglöckchen. Insbesondere nach der Scheidung von Herwarth Walden lebte sie teilweise unter prekären Bedingungen und war immer wieder von Geldsorgen geplagt. Die meiste Zeit ab etwa 1916 wohnte sie in Hotels, in Pensionen und bei Freunden.
Else Lasker-Schüler sympathisierte mit den Ideen der Lebensreformbewegung und setzte sich für freie Liebe, Verhütungsmittel und die Abschaffung des Abtreibungsparagrafen 218 RStGB ein. Offenbar kam ihr dabei eine gewisse integrative Kraft zu. Kurt Hiller schrieb nach dem Zweiten Weltkrieg an die befreundete lesbische Berliner Journalistin Eva Siewert (1907–1994): „Die hysterische Tribade mit Männerfeindschaft war fin-de-siècle ein verhältnismäßig verbreiteter Typus, welcher sogar, wegen seiner Komik, einige Popularität genoss, aber doch bereits um 1910, sicher 1920 überwunden war, nicht ohne Hilfe erfreulicher Frauengestalten wie Helene Stöcker, Else Lasker-Schüler oder Renée Sintenis. In den Kreisen des Kartells für Reform des Sexualstrafrechts galt es einfach als schlechter Ton, die Propaganda der Freiheit für androtrope Männer mit Antifeminismus zu verbinden oder die feministische Propaganda mit Feindseligkeiten gegen den Mann.”
Wann genau Else Lasker-Schüler Magnus Hirschfeld kennengelernt hat, ist nicht belegt, aber die zwei verband über viele Jahre hinweg eine enge Freundschaft. In einem „Offenen Brief an Zürcher Studenten“ hielt Else Lasker-Schüler schon 1918 fest: „Ich will Ihnen etwas erzählen von unserem Doktor […]. Mitten im Tiergarten zwischen starken Kastanienbäumen und hingehauchten Akazien wohnt Sanitätsrat Doktor Magnus Hirschfeld […]. Er ist der Bejaher jeder aufrichtigen Liebe, ein Abgewandter jeglichen Hasses […]. Wenn er nicht in Berlin ist, fehlt sozusagen unser Beichtvater. Wir sehnen uns alle nach seinem Trostwort, nach den gemütlichen, gemütsvollen grünen Zimmern, sie sind heilbringend wie er selbst.“ Der Text ist online hier nachzulesen.
Bereits ab 1915 verbrachte Else Lasker-Schüler regelmäßig mindestens zwei Sommermonate im hinterpommerschen Kolberg (heute Kołobrzeg) in der Ostseevilla „Agnes“, die von Hirschfelds Schwestern Agnes Hirschfeld und Jenny Hauck betrieben wurde. Nirgends soll Else Lasker-Schüler glücklicher gewesen sein. Als im Juli 1931 auch in Kolberg eine „Strandkompanie“ für „judenfreie Bäder“ gegründet wurde und die Anfeindungen gegen jüdische Gäste in dem Strandbad überhandnahmen, musste Else Lasker-Schüler den Sommerort für immer verlassen.
1932 erhielt Else Lasker-Schüler den renommierten Kleist-Preis für ihr literarisches Gesamtwerk, doch war sie zu dem Zeitpunkt als Dichterin in der deutschen Gesellschaft stark umstritten. Von den Nationalsozialisten wurde sie befehdet, ihre Bücher wurden wenig später bei der Bücherverbrennung verbrannt und ihre Bilder als „entartete Kunst“ aus öffentlichen Sammlungen entfernt, sie selbst von SA-Männern auf offener Straße niedergeschlagen. 1938 wurde ihr die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt.
Von Berlin aus flüchtete Else Lasker-Schüler im April 1933 zunächst in die Schweiz, von wo sie 1939 nach Palästina ausreiste. Die letzten Jahre ihres Lebens verbrachte sie in Jerusalem. Sie war hier indes tief verzweifelt und vom Leben in ihrem „Hebräerland“ enttäuscht. Den Verlust der Heimat hat sie nie verwunden. Zu ihrer Isolierung und Vereinsamung trug schließlich bei, dass sie auch in Palästina keine Vorträge halten durfte, weil sie hierzu die deutsche Sprache verwendete. Hebräisch hat Else Lasker-Schüler nie gelernt.
Else Lasker-Schüler starb am 22. Januar 1945 an einem Herzleiden in Jerusalem. Ihr Grab auf dem Jüdischen Friedhof am Ölberg wurde wie viele andere dortige Gräber zerstört, nachdem der Ölberg 1948 unter jordanische Verwaltung gekommen war. Der Grabstein wurde 1967 neben einer Schnellstraße gefunden, die die jordanische Verwaltung 1960 quer über den alten Friedhof hatte bauen lassen. Heute erinnert hier ein neuer Grabstein an Else Lasker-Schüler und ihr früheres Grab.
Werke (Auswahl)
Lasker-Schüler, Else (1902): Styx. Gedichte. Berlin: Juncker.
Lasker-Schüler, Else (1909): Die Wupper. Schauspiel in fünf Aufzügen. Berlin Oesterheld. (Uraufführung 1919).
Lasker-Schüler, Else (1911): Meine Wunder. Gedichte. Karlsruhe und Leipzig: Dreililien.
Lasker-Schüler, Else (1918): Doktor Magnus Hirschfeld. Ein offener Brief an die Zürcher Studenten, in: Züricher Post und Handelszeitung vom 10.7.1918 (auch in Lasker-Schüler, Else: Essays 1920, S. 29-31).
Lasker-Schüler, Else (1919): Der Malik. Eine Kaisergeschichte. Berlin: Cassirer.
Lasker-Schüler, Else (1928): Paradiese. In: Berliner Tageblatt vom 27.5.1928 (Morgenausgabe), S. 2.
Lasker-Schüler, Else (1937): Das Hebräerland. Prosa. Zürich: Oprecht.
Lasker-Schüler, Else (1943): Mein blaues Klavier. Neue Gedichte. Jerusalem: Jerusalem Press.
Lasker-Schüler, Else (2017, Nachdruck): Kolberg. Als man dort noch nicht von Hakenkreuzlern bedroht wurde. In: Mitteilungen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft, Nr. 57, S. 27-29.
Weiterführende Literatur
Aufenanger, Jörg (2019): Else Lasker-Schüler in Berlin. Berlin: be.bra verlag GmbH.
Bauschinger, Sigrid (2004): Else Lasker-Schüler. Eine Biographie. Göttingen: Wallstein.
Bircher, Martin (1995): „Die grösste Lyrikerin, die Deutschland je hatte”. Zu Else Lasker-Schülers 50. Todestag und zum Fund eines Koffers aus ihrem Besitz. In: Librarium: Zeitschrift der Schweizerischen Bibliophilen-Gesellschaft = revue de la Société Suisse des Bibliophiles Jg. 38, Nr. 2, S. 122-145, online hier.
Hoefert, Thomas (2002): Signaturen kritischer Intellektualität. Else Lasker-Schülers Schauspiel Arthur Aronymus. St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag.
Klüsener, Erika (1980): Else Lasker-Schüler. In Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Reinbek: Rowohlt.
Loeper, Heidrun. Hrsg. (2012): Else Lasker-Schüler. Die kreisende Weltfabrik. Berliner Ansichten und Porträts. Berlin: Transit Buchverlag.
Zehl Romero, Christiane (o.J.): Else Lasker-Schüler, auf fembio. Frauen.Biographieforschung.
Mann, Franziska (Schriftstellerin) geb. 9.6.1859 (Kolberg, heute Kołobrzeg, Polen) – gest. 8.12.1927 (Berlin)
Zur Biografie


Unklar ist vor diesem Hintergrund, wie eng sich das Zusammenleben zwischen Franziska und Moritz Mann gestaltete und wie weit Franziska Mann etwa in die geschäftlichen Aktivitäten ihres Mannes einbezogen war. Moritz Mann betrieb ab 1888 das Passage-Hotel in der Berliner Behrenstraße 52. In diesem Hotel bewohnte Franziska Mann in einer der unteren Etagen ein kleines „Stübchen“. Hier führte sie „ihr eigenes nachdenkliches Leben“. Gleichwohl habe sie aber immer Zeit gefunden, „sich ein wenig um den Hotelbetrieb zu kümmern. Jeder Gast, den sie kannte, konnte ihrer Aufmerksamkeit sicher sein.“
Die Beziehung Franziska Manns zu ihrem Bruder Magnus Hirschfeld war recht eng. Möglicherweise war Hirschfeld sogar der maßgebliche Inspirator für Manns Wirken als Schriftstellerin. So heißt es, „rege und kluge Teilnahme an den Studien und Forschungen des Bruders mögen ihr den Blick auf das unendliche Leid in der Welt geöffnet, mögen ihr die Feder in die Hand gedrängt haben.“ Als Franziska Manns Debüt gilt die Erzählung Könige ohne Land (1903). In ihr schildert die Autorin den Lebensweg einer Frau, die sich ganz auf sich gestellt durchs Leben schlagen muss. Dies war auch ein wiederkehrendes Motiv in mehreren ihrer folgenden Werke.
Franziska Mann und Magnus Hirschfeld hegten ähnliche emanzipatorische und humanitäre Interessen – sie als Schriftstellerin und Frauenrechtlerin, er als Arzt und Sexualreformer. Hinzu kommt, dass sich Franziska Mann während des Ersten Weltkrieges und in den Jahren danach wohltätig in der Fürsorge für alleinstehende und verarmte Frauen betätigte. So richtete sie von 1921 bis zu ihrem Tod 1927 zusammen mit der Dichterin Lucy Abels-Avellis (1874–1938) im 1905 gegründeten renommierten Lyceum Club Unterhaltungsabende für Frauen des Mittelstandes aus. Aber schon um 1904 gehörte sie wie ihr Bruder Magnus Hirschfeld und andere in dessen Wissenschaftlich-humanitären Komitee (WhK) dem Beirat des Charlottenburger „Verbandes zum Schutze für Nichtraucher” an. Dessen Erster Vorsitzender war der ehemalige Distriktsarzt Karl von Oppell (1839–?), der zuvor in Südafrika tätig gewesen war.
Franziska Mann engagierte sich auch für das Frauenwahlrecht. Kurz bevor das gleiche Wahlrecht für alle volljährigen Männer und Frauen in Deutschland 1919 erstmals verwirklicht wurde, versuchten Franziska Mann und Magnus Hirschfeld in einer Flugschrift Was jede Frau vom Wahlrecht wissen muß! (1918) die zukünftigen Erstwählerinnen auf ihr neu gewonnenes Recht vorzubereiten. Franziska Mann und Magnus Hirschfeld widmeten die Publikation der Schriftstellerin und Frauenrechtlerin Hedwig Dohm, die sie als „Patriarchin und Pionierin des deutschen Frauenstimmrechts” bezeichneten.
Als eins ihrer persönlichsten Werke betrachtete Franziska Mann offensichtlich ihr Buch Vom Mädchen mit dem singenden Herzen (1904). In Anspielung auf diesen Titel ist Franziska Mann in mehreren Nachrufen als „die Frau mit dem singenden Herzen“ bezeichnet worden. Anna Plothow (1853–1924), die Redakteurin der „Frauenrundschau“ des Berliner Tageblatts, schrieb, Franziska Mann sei einst unter vielen Menschen, die sie kennengelernt habe und die sich als „eigen“ zu geben trachteten, wirklich eine „Eigene“ gewesen: „Ein einsamer Mensch. Einsam im lauten Treiben der Welt, einsam in der Gemeinschaft der Genossen.“
Zu ihren engsten Freundinnen zählte Franziska Mann die jüdische Berliner Pazifistin, Fotografin und Pensionsinhaberin Margarete Schurgast. Eine andere Frau, die Franziska Mann Anfang des Zwanzigsten Jahrhunderts sehr nahe stand, war die österreichische Schriftstellerin Amalie Falke von Lilienstein (1871–1956). Franziska Mann stand auch in brieflichem Austausch mit der schwedischen Sozialreformerin Ellen Key und den Schriftstellerinnen Minna Cauer, Elisabeth Dauthendey, Hedwig Dohm, Gabriele Reuter (1859–1941) und anderen. Belegt ist ferner, dass sie am 2. Februar 1924 neben Gertrud Eysoldt und Käthe Kollwitz an einer Feierlichkeit im Institut für Sexualwissenschaft teilnahm.
Franziska Mann starb am 8. Dezember 1927 und wurde auf dem Jüdischen Friedhof in Berlin-Weißensee beigesetzt.
Nachlass
Der Nachlass Franziska Manns ist verschollen. Doch sammelt die Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft ihre Briefe, soweit diese erhalten sind. Kleinere Konvolute mit Briefwechseln zwischen Franziska Mann und ihr befreundeten Schriftstellerinnen wie Anna Kappstein (1872–1950), Anna Plothow und anderen können in unserem Archiv eingesehen werden.
Schriften (Auswahl)
Mann, Franziska (1903): Könige ohne Land. Erzählung. Leipzig: Verlag der Frauen-Rundschau.
Mann, Franziska (1904): Vom Mädchen mit dem singenden Herzen. Berlin, Leipzig: Verlag von Hermann Seemann Nachfolger.
Mann, Franziska (1909): Von Kindern. Berlin-Charlottenburg: Axel Juncker Verlag.
Mann, Franziska (1912): Frau Sophie und ihre Kinder. Frankfurt a. M.: Rütten & Loening.
Hirschfeld, Magnus und Mann, Franziska (1918): Was jede Frau vom Wahlrecht wissen muß! Berlin: Alfred Pulvermacher (online hier zugänglich).
Mann, Franziska [1919]: Der Schäfer. Eine Geschichte aus der Stille (Juncker-Bücher, 3). Berlin: Axel Juncker Verlag.
Mann, Franziska (1921): Den Erwachenden. Aus dunkler Gegenwart in hellere Zukunft. Berlin: Edition Jacobi Verlags-AG.
Mann, Franziska (1921): Flug ins Kinderland. Ein Buch für Große. Berlin: Edition Jacobi Verlags-AG.
Mann, Franziska (1922): Die Stufe. Fragment einer Liebe. Berlin: Mosaik Verlag.
Mann, Franziska (o.J.): Alte Mädchen. Erzählungen. Leipzig: Verlag der Frauen-Rundschau.
Weiterführende Literatur
Anonym (1924): Eine neue wissenschaftliche Stiftung in Berlin [Kurzmeldung unter „Kunst / Wissen / Leben“], in: Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung, 6.2.1924 (Jg. 82, Nr. 31), S. 2.
Dose, Ralf (2004): Die Familie Hirschfeld aus Kolberg. In: Elke-Vera Kotowski und Julius H. Schoeps (Hrsg.): Magnus Hirschfeld. Ein Leben im Spannungsfeld von Wissenschaft, Politik und Gesellschaft (Sifria. Wissenschaftliche Bibliothek, 8). Berlin: be.bra wissenschaft, S. 33-64.
Jank, Dagmar (2020): Die Journalistin und Frauenrechtlerin Anna Plothow (1853–1924). Eine biographische Annäherung, in: Berlin in Geschichte und Gegenwart 2020, S. 7-25, hier S. 23-24.
Key, Ellen (1919): Als ich das erste Mal Franziska Mann traf, in: Franziska Mann. Der Dichterin – Dem Menschen! Zum 9. Juni 1919. Jena: Landhausverlag, S. 3-4.
Wolfert, Raimund (2017): Annäherungen an Franziska Mann – Schriftstellerin und Briefpartnerin Ellen Keys. In: Mitteilungen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft, Heft 58/59, S. 45-64.
Meisel-Hess, Grete (Schriftstellerin) geb. 18.4.1879 (Prag, damals Österreich-Ungarn) – gest. 18.4.1922 (Berlin)
Zur Biografie


Grete Meisel-Hess schrieb Gedichte, Novellen, Romane und Essays, und bereits ihre Kritik an der frauenfeindlichen Schrift Geschlecht und Charakter des österreichischen Philosophen und Psychologen Otto Weininger (1880–1903) machte sie bekannt. Die Autorin setzte sich in anderen Schriften auch mit Friedrich Nietzsche, Ernst Haeckel und Wilhelm Bölsche in Zusammenhang mit Fragen zu Individualismus und Sozialismus auseinander. In der „Regulierung der Frauenfrage durch Ermöglichung einer neuen Ehe“ sah sie das Ziel eines neuen Staatsgebäudes, des „Individual-Sozialismus“.
Grete Meisel ging 1900 die Ehe mit Peter Hess ein, die jedoch bereits ein Jahr später wieder geschieden wurde. 1908 zog sie nach Berlin, wo sie im Bund für Mutterschutz (BfM) und in der Internationalen Liga für Mutterschutz und Sexualreform aktiv wurde. 1910 wurde sie neben Helene Stöcker, Heinrich Stabel und anderen in den Ortsvorstand des BfM gewählt. Grete Meisel-Hess publizierte in der Zeitschrift des BfM und in Sammelbänden der frühen „Radikalfeministen“ und hielt daneben auch zahlreiche Vorträge, etwa vor dem Wissenschaftlich-humanitären Komitee (WhK) und im großen Saal der Singakademie in Berlin. Hier sprach sie am 12. November 1911 zum Thema „Für und wider die Ehe“.
In Berlin lernte Grete Meisel-Hess ihren zweiten Mann, den Architekten Oskar Gellert kennen. Die beiden gingen 1909 die Ehe ein, die jedoch einigen Belastungen ausgesetzt war. Offenbar aus finanziellen Überlegungen heraus kehrte Grete Meisel-Hess nach einer vorübergehenden Trennung zu ihrem zweiten Ehemann zurück. Sie hatte ihm ihr Vermögen als Heiratsgut gegeben.
Ab etwa 1917 lebte Grete Meisel-Hess zusammen mit ihrer verwitweten Mutter in finanziell prekären Verhältnissen. Von Freunden und Bekannten musste sie sich immer wieder Geld leihen. In den letzten Jahren ihres Lebens litt Grete Meisel-Hess zudem an Depressionen und unter anderen psychischen Problemen. So hörte sie Stimmen. Die Ursache für ihre Erkrankung sah sie selbst darin, dass sie im Oktober 1918 an einer spiritistischen Sitzung teilgenommen hatte. Ab 1919 fragte sie beim Mosse-Stift in Berlin um Unterstützung an, weil sie nervenleidend sei und nicht viel verdiene. Mehrfach ließ sie sich in die Nervenklinik der Charité einweisen.
Grete Meisel-Hess starb am 18. April 1922, ihrem 43. Geburtstag, offiziell an einer Mittelohrentzündung. Helene Stöcker, die Mitbegründerin des BfM, gedachte ihrer Weggefährtin in einem Nachruf mit den Worten: „Sie war nicht nur eine der begabtesten, geistreichsten, energischsten Frauen, die für die Gleichberechtigung der Frau eintraten, sondern auch eine der angesehensten Vorkämpferinnen der Bewegung für Sexualreform, deren hohe schriftstellerische Begabung in einer Reihe von wertvollen Werke Gestalt gewonnen hat […]. Die letzten Jahre ihres Lebens waren durch ein schweres nervöses Leiden getrübt, das sie oft zur Verzweiflung zu bringen drohte.“
Grete Meisel-Hess gehörte nach der Einführung des allgemeinen Wahlrechts auch für Frauen in Deutschland neben Lou Andreas-Salomé, Louise Dumont, Gertrud Eysoldt, Käthe Kollwitz, Adele Schreiber und Helene Stöcker zu den sieben erstunterzeichnenden Frauen der Petition des Wissenschaftlich-humanitären Komitees (WhK) gegen den § 175 RStGB, der mann-männliche Sexualkontakte mit Strafe belegte.
Schriften (Auswahl)
Meisel-Hess, Grete (1903): Suchende Seelen. Drei Novellen. Leipzig: Hermann Seemann Nachfolger. Online hier.
Meisel-Hess, Grete (1904): Weiberhaß und Weiberverachtung. Eine Erwiderung auf die in Dr. Otto Weiningers Buche „Geschlecht und Charakter” geäußerten Anschauungen über „Die Frau und ihre Frage”. Wien: Die Wage. Online hier.
Meisel-Hess, Grete (1909): Die sexuelle Krise. Eine sozialpsychologische Untersuchung. Jena: Diederichs.
Meisel-Hess, Grete (1911): Die Intellektuellen. Roman. Berlin: Oesterheld & Co.
Meisel-Hess, Grete (1916): Das Wesen der Geschlechtlichkeit. Die sexuelle Krise in ihren Beziehungen zur sozialen Frage & zum Krieg, zu Moral, Rasse & Religion & insbesondere zur Monogamie. Zwei Bände. Jena: Diederichs.
Meisel-Hess, Grete (1917): Die Bedeutung der Monogamie. Jena: Eugen Diederichs.
Weiterführende Literatur
Bittermann-Wille, Christa (2019): Grete Meisel-Hess, auf: Frauen in Bewegung 1848–1938 (Ariadne – Österreichische Nationalbibliothek).
Good, David F., Margarete Grandner und Mary Jo Maynes. Hrsg. (1994): Frauen in Österreich. Beiträge zu ihrer Situation im 20. Jahrhundert. Wien, Köln, Weimar: Böhlau, S. 168-189.
Melander, Ellinor (1990): Sexuella krisen och den nya moralen. Förhållandet mellan könen i Grete Meisel-Hess’ författarskap (Akademisk avhandling; Stockholm Studies in the History of Ideas, 1). Stockholm: Almqvist & Wiksell International.
Stöcker, Helene (1922): Grete Meisel-Hess †, in: Die Neue Generation (Jg. 18), Nr. 4, S. 174.
Thorson, Helga (2022): Grete Meisel-Hess. The New Woman and the Sexual Crisis. Rochester, New York: Camden House.
Weitere Quellen
Die Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft hat im März 2015 mit Hilfe privater Sponsoren und der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld fünf Briefe Magnus Hirschfelds an Grete Meisel-Hess aus den Jahren 1914 bis 1919 erworben. Um 1914 stand Grete Meisel-Hess nachweislich auch mit Franziska Mann, Magnus Hirschfelds Schwester, in brieflicher Verbindung.
Mensch, Ella (Dr. phil., Schriftstellerin) geb. 5.3.1859 (Lübben) – gest. 5.5.1935 (Berlin)
Zur Biografie


Als Ella Mensch 1884 nach Deutschland zurückkehrte, begann sie für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften wie das Darmstädter Tagblatt zu schreiben, vornehmlich über Oper und Theater. Sie arbeitete zunächst mehrere Jahre als Lehrerin an höheren Mädchenschulen in Hessen, außerdem gab sie Rezitationsabende und hielt literarische Vorträge. 1904 zog sie nach Berlin und wurde in der Nachfolge von Helene Stöcker Redakteurin der Frauen-Rundschau.
Innerhalb der deutschsprachigen Frauenbewegung stand Ella Mensch den „Gemäßigten“ nahe. Sie sprach sich gegen die Abwertung eines ehelosen und sexuell enthaltsamen Lebensstils aus und betonte stets die Lebensleistungen der berufstätigen, nicht verheirateten Frau. In ihren Schriften nahm sie mehrfach homophobe Positionen ein und wies Verbindungen zwischen der Frauenbewegung und Homosexualität zurück. Dabei griff sie unter anderem wiederholt Anna Rüling alias Theo Anna Sprüngli an, der sie unterstellte, es gehe ihr und ihrer „Klique“ um „sensationslüsterne Neigungen“. Die Frauenbewegung müsse sich gegen Bestrebungen wehren, die „das Triebleben an die Stelle des geistigen Wachstums“ rücken wollten.
Dies hinderte Ella Mensch jedoch nicht daran, über eine Versammlung der Freunde des Bundes für Mutterschutz, in der es um die damals diskutierte Ausdehnung des § 175 RStGB auf Frauen ging, 1911 ausgesprochen wohlwollend zu referieren. Über Magnus Hirschfeld, der zu den Rednern der Veranstaltung gehörte, schrieb Mensch: „In den Darlegungen Dr. Hirschfelds kam der Arzt, der Naturforscher und vor allem der warme Menschenfreund, der ja nicht auf Grund einer grauen Theorie, sondern aus umfangreicher ärztlicher Praxis heraus seine Diagnosen stellt, zum überzeugenden Ausdruck, und wir pflichten ihm darin bei, daß angesichts der Dummheit, Bosheit und Beschränktheit, die sich noch immer in der Behandlung dieser Fragen kundgibt, der ‚Bund für Mutterschutz’ durch die Einberufung dieser Versammlung lobenswerten Mut bewiesen habe.“
Ella Mensch starb am 5. Mai 1935 im Alter von 76 Jahren in Berlin.
Schriften (Auswahl)
Mensch, Ella (1902): Der Geopferte. Liebesroman eines modernen Mannes. Leipzig: Seemann.
Mensch, Ella (1903): Auf Vorposten. Roman aus meiner Züricher Studentenzeit (Moderne Frauenbibliothek, 19). Leipzig: Verlag der Frauen-Rundschau.
Mensch, Ella (1904): Grober Unfug. In: Frauen-Rundschau (Jg. 5), Nr. 45, S. 1389-1390.
Mensch, Ella (1906): Bilderstürmer in der Berliner Frauenbewegung (Großstadt-Dokumente, 26). Berlin: Seemann.
Mensch, Ella (1907): Eine Frau über § 175, in: Die Große Glocke, 21.11.1907.
Mensch, Ella (1911): Aus der Frauenbewegung. Eine Initiative des Bundes für Mutterschutz, in: Frauen-Rundschau (Jg. 12), Nr. 5.
Mensch, Ella (1996): Das „dritte Geschlecht”, in: Ariadne. Almanach des Archivs der deutschen Frauenbewegung, Nr. 29, S. 29 [Wiederabdruck].
Weiterführende Literatur
Budke, Petra und Jutta Schulze (1995): Schriftstellerinnen in Berlin 1871–1945. Ein Lexikon zu Leben und Werk. Berlin: Orlanda-Frauenverlag.
Heinrich, Elisa (2022): Intim und respektabel. Homosexualität und Freundinnenschaft in der deutschen Frauenbewegung um 1900. Göttingen: V&R unipress, hier vor allem S. 205-207.
Michel, Louise (Autorin, Anarchistin) geb. 29.5.1830 (Vroncourt-la-Côte, Frankreich) – gest. 9.1.1905 (Marseille, Frankreich)
Zur Biografie


Während der Pariser Kommune im Deutsch-Französischen Krieg 1871 war Louise Michel in einem Wachkomitee tätig. Sie beteiligte sich in männlicher Uniform am bewaffneten Widerstand gegen die preußischen Belagerer von Paris wie die französische Zentralregierung. Sie arbeitete aber auch als Krankenpflegerin und vorsorgte Menschen, die auf den Barrikaden verwundet worden waren oder Hunger litten. Um diese Zeit war sie eng mit Théophile Ferré (1845–1871) verbunden, der im November 1871 hingerichtet wurde. Louise Michel widmete ihm das Gedicht „L‘œillet rouge“ („Die rote Nelke“). Der französische Schriftsteller Victor Hugo (1802–1885) wiederum widmete Louise Michel das Gedicht „Viro major“ („Dem Mann überlegen“), das maßgeblich zu ihrer Bekanntheit beitrug.
Nachdem der Volksaufstand blutig niedergeschlagen worden war, wurde Louise Michel zu einer langjährigen Gefängnisstrafe verurteilt, die sie zum Teil in der Verbannung in Neukaledonien (Pazifik) verbrachte. In dieser Zeit wurde ihr von der französischen Bevölkerung der Name „La vierge rouge“ („Die rote Jungfrau“) gegeben.
Louise Michel kehrte 1880 nach Frankreich zurück, wurde jedoch 1883 erneut zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt, weil sie zu Plünderungen aufgerufen hatte. Eine Begnadigung 1885 lehnte sie ab. 1888, zwei Jahre nachdem sie ihre Memoiren herausgegeben hatte, wurde sie von einem katholischen Royalisten mit zwei Pistolenschüssen am Kopf verletzt, und 1890 musste sie eine kürzere Zeit als vermeintlich Geistesgestörte in einer Nervenheilanstalt verbringen, woraufhin sie Frankreich verließ und nach London zog. Erst 1895 kehrte sie in ihr Heimatland zurück.
Louise Michel schrieb auch Dramen und einen Roman und hielt Vorträge zum Sozialismus, gegen die Diskriminierung der Frau, für eine kindgerechte Erziehung, gegen Krieg, Ausbeutung und Unterdrückung, Kolonialismus und Rassismus und für einen verantwortungsbewussten Umgang mit der Natur und den Tieren. Sie starb am 9. Januar 1905 in Marseille.
Wenige Monate nach ihrem Tod veröffentlichte der österreichische Schriftsteller Karl Freiherr von Levetzow (1871–1945) im Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen eine eigenwillige Studie, in der er Louise Michel zur „urnischen“, das heißt lesbischen Frau erklärte. Von Levetzow behauptete, es komme zur Charakterisierung eines Menschen als „Uranier“ nicht auf die Betätigung an, sondern lediglich auf gewisse einschlägige Merkmale: „das psychische Profil“. Im Folgenden hob er all das hervor, was er an Michel als „männlich“ erlebte und in seinen Augen seine Einschätzung stützte.
Die Darstellung Karl von Levetzows provozierte knapp zwanzig Jahre später die amerikanische Anarchistin Emma Goldman im Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen zu einer Erwiderung. Magnus Hirschfeld schrieb hierzu eine kurze Einleitung. Goldman, die Louise Michel in England persönlich kennen gelernt hatte und über mehrere Jahre mit ihr im persönlichen Kontakt stand, attestierte von Levetzow eine „antiquierte Auffassung über den Wesensinhalt des Weibes“, widersprach ihm in fast allen Punkten und betonte, Louise Michel repräsentiere schlichtweg „einen neuen Typus der Weiblichkeit.“ Die vermeintliche „Beweisführung“ von Levetzows, so Goldman, speise sich aus Argumenten, „wie sie seit undenklichen Zeiten von Männern aller Schattierungen der Frau entgegengehalten wurden, wenn sie versuchte, aus ihrer gesellschaftlichen Stellung als Haremsdame herauszukommen und es wagte, einen gleichen Platz mit dem Manne im Leben zu fordern.“
In persönlichen, an Magnus Hirschfeld gerichteten Worten bat Emma Goldman darum, Hirschfeld möge „das Bild Louise Michels aus der Galerie der Urninge entfernen”.
Weiterführende Literatur
Geber, Eva. Hrsg. (2019): Louise Michel. Texte und Reden. Wien: bahoe books.
Goldmann, Emma (1923): Offener Brief an den Herausgeber der Jahrbücher über Louise Michel. In: Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen 23, S. 70-92.
Hervé, Florence. Hrsg. (2021): Louise Michel oder: Die Liebe zur Revolution. Berlin: Dietz Verlag.
Levetzow-Marseille, Karl Freiherr von (1905): Louise Michel. In: Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen 7 (Teilband 1), S. 307-370.
Michel, Louise (2017): Memoiren. Erinnerungen einer Kommunardin (Klassiker der Sozialrevolte, 27). Münster: Unrast Verlag.
Pusch, Luise F. (o.J.): Louise Michel, auf: Fembio. Frauen.Biographieforschung.
Pappritz, Anna (Schriftstellerin) geb. 9.5.1861 (Radach, heute Radachów, PL) – gest. 8.7.1939 (Radach, heute Radachów, PL)
Zur Biografie


Als ihr Vater 1877 starb, zog die Mutter mit ihrer Tochter und ihrem jüngsten Sohn nach Berlin. 1893 veröffentlichte Anna Pappritz hier einen Novellenband, in dem sich bereits erste Ansätze für ihre späteren frauenpolitischen Standpunkte finden. Ihr zweites, autobiographisch gefärbtes Buch Vorurteile – ein Roman aus dem Märkischen Gesellschaftsleben führte wegen seines Bekenntnischarakters nach eigenen Angaben Pappritz‘ zu einer jahrelangen Entfremdung von ihrer Familie.
Als Anna Pappritz 1895 zum ersten Mal nach England reiste, kam sie mit der dortigen Frauenbewegung in Berührung. Sie nahm hier auch zum ersten Mal Kenntnis von der Prostitution, einem Phänomen, von dem sie in Deutschland noch nichts vernommen hatte. Nach ihrer Rückkehr nach Berlin besuchte sie mehrere Treffen in Vereinen der Frauenbewegung und bot schließlich Minna Cauer und deren „Verein Frauenwohl“ die Mitarbeit an. Fortan betreute sie die neu gegründete Bibliothek des Vereins, der alle relevanten Werke neueren wie älteren Datums zur Frauenfrage sammelte. Ihren ersten frauenpolitischen Artikel publizierte Anna Pappritz 1896 in der Zeitschrift Die Frauenbewegung unter dem Titel „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.“
In anschließenden Beiträgen zur Prostitution griff Anna Pappritz in ihrer Zeit gängige Vorstellungen von Sittlichkeit an und warf dem „Bund Deutscher Frauenvereine“ (BDF) Doppelmoral vor. Die heftig geführten Auseinandersetzungen veranlassten Anna Pappritz, einen abolitionistischen Sittlichkeitsverein zu gründen, der ihre Lebensaufgabe wurde. In eigenständigen Publikationen, fast allen Zeitschriften der bürgerlichen Frauenbewegung und in der allgemeinen Presse sowie durch unzählige Vortragsabende wurde Anna Pappritz zu einer der bekanntesten Expertinnen ihrer Zeit zu Fragen der Sexualmoral und Sexualhygiene im deutschen Sprachraum. Als die „Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten“ (DGBG) 1902 gegründet wurde, wurde Anna Pappritz als einzige Frau in den Vorstand der Vereinigung gewählt.
Anna Pappritz lernte um 1899 ihre spätere Lebensgefährtin Margarete Friedenthal (1871–1957) kennen, mit der sie von Ende der 1920er Jahre bis zu ihrem Tod 1939 zusammenwohnte. Nach dem Ersten Weltkrieg verschlechterte sich ihre finanzielle Situation beträchtlich, so dass sie erstmals einer Erwerbstätigkeit nachgehen musste. Gleichwohl führte sie ihre publizistischen Tätigkeiten wie ihr Engagement zur Abschaffung jeglicher Reglementierung der Prostitution unvermindert weiter. Als der Reichstag 1927 ein Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten verabschiedete, mit dem auch die Strafbarkeit der Prostitution abgeschafft wurde, konnte Anna Pappritz dies als ihren bis dahin größten Erfolg feiern.
Indes waren die neuen rechtlichen Bestimmungen nicht von langer Dauer. Schon Anfang der 1930er Jahre führten die Nationalsozialisten die Reglementierung der Prostitution wieder ein und genehmigten später auch wieder Bordelle, für deren Abschaffung Anna Pappritz und ihre Mitstreiter und Mitstreiterinnen stets eingetreten waren. Die tatsächliche Wiedereinführung des Bordellwesens in Deutschland erlebte Anna Pappritz jedoch nicht mehr. Im Sommer 1939 war sie zusammen mit ihrer Lebensgefährtin Margarete Friedenthal in ihren Heimatort Radach gefahren. Hier starb sie am 8. Juli 1939 nach einer schweren Bronchitis. Die Inschrift auf ihrem Grabstein, der lange nach Pappritz’ Tod von entfernten Verwandten aufgestellt wurde, ist insofern fehlerhaft, als sie behauptet, Anna Pappritz sei in Berlin gestorben.
Magnus Hirschfeld wandte sich Anfang 1908 schriftlich an Anna Pappritz, um sie für einen Beitrag in der Zeitschrift für Sexualwissenschaft zu gewinnen. Auch darüber hinaus war Hirschfeld an einem Kontakt mit Pappritz interessiert. Er schrieb: „Gern würde ich einmal Gelegenheit nehmen, mich einmal mit Ihnen ein Stündchen persönlich zu unterhalten.“ Doch Pappritz‘ Antwort war negativ. Pappritz gab sich überzeugt, Hirschfeld habe ein falsches Frauenbild, sie lehnte „aus prinzipiellen Gründen“ ab, etwas in der Zeitschrift für Sexualwissenschaft zu veröffentlichen.
Pappritz schrieb am 29. Februar 1908 an Magnus Hirschfeld: „Aus den verschiedenen Schriften von Ihnen, die ich gelesen habe, geht hervor, dass Sie jene verweichlichten und überzarten Frauentypen, die das Großstadtleben erzeugt, für den Normaltypus der Frau halten, und dass Ihnen gesunde, starke Frauennaturen, die nicht nur in Putz und Tant aufgehen, sondern die entweder geistige Interessen pflegen oder eine gesunde Lust an körperlichen Bewegungen haben, schon ein Hinneigen zum männlichen Typus verraten. Ja selbst die Freude kleiner Mädchen an wilden Spielen, die meines Erachtens in jedem normalen Mädchen zu finden ist, erscheint Ihnen als etwas anormales. Ich halte, wie gesagt, diese Ihre Auffassung für geradezu verhängnisvoll für das weibliche Geschlecht, weil wir m.E. bestrebt sein müssen, wieder kraftvolle, geistige und körperlich gesunde Frauen zu erziehen und die Interessen der Frau zu vertiefen und erweitern.“
Schriften (Auswahl)
Pappritz, Anna: Herrenmoral. Leipzig: Verlag der Frauen-Rundschau 1903.
Pappritz, Anna: Die Wohnungsfrage. Leipzig/Berlin: Teubner 1908.
Pappritz, Anna (1909): Die Prostitution als sozial-ethisches Problem, in: Gertrud Bäumer u. a. (Hrsg.): Frauenbewegung und Sexualethik. Beiträge zur modernen Ehekritik. Heilbronn: Eugen Salzer, S. 163-176.
Pappritz, Anna und Katharina Scheven (1909): Die positiven Aufgaben und strafrechtlichen Forderungen der Föderation (Abolitionistische Flugschriften 5). Dresden: Kupky & Dietze 1909.
Pappritz, Anna (1911): Paragraph 175 im Vorentwurf zum neuen Strafgesetzbuch, in: Die Frauenbewegung. Revue für die Interessen der Frauen (Jg. 17), Nr. 5 (vom 1.3.1911), S. 33-34.
Weiterführende Literatur (Auswahl)
Heinrich, Elisa (2022): Intim und respektabel. Homosexualität und Freundinnenschaft in der deutschen Frauenbewegung um 1900. Göttingen: V&R unipress, hier vor allem S. 208-214.
Wolff, Kerstin (2009): Der siebzigste Geburtstag. Die Abolitionistin Anna Pappritz und der Kreis ihrer Gratulantinnen. In: Ariadne, Nr. 55 (Mai 2009), S. 26-33.
Wolff, Kerstin (2017): Anna Pappritz 1861–1939. Die Rittergutstochter und die Prostitution. Sulzbach/Taunus: Helmer.
Richter, Dora (Küchenhilfe, Köchin) geb. 16.4.1892 (Seifen, heute Ryžovna, CZ) – gest. nach 1939 (Ort nicht belegt)
Zur Biografie


Schon als Kind indes zeigte Dora alias Rudolph Richter Interesse für Mädchenkleidung, Mädchenspiele und Mädchengesellschaft, während sie eine wahre Abneigung gegen alle Raue, Derbe und Grobe an den Tag legte, das sie mit Jungen in Verbindung brachte. Richter wurde katholisch erzogen und suchte in Krisenzeiten immer wieder Trost und Rückhalt in der Religion. Nach eigenen Aussagen unternahm sie mehrere Versuche, sich das Leben zu nehmen, und hegte gegen ihre männlichen Geschlechtsorgane einen regelrechten Hass.
Nach einer Bäckerlehre zog Dora Richter um 1909 in eine größere Stadt, bei der es sich vermutlich um Karlsbad (Karlovy Vary) handelte. Hier kleidete sie sich in ihrer Freizeit als Mädchen bzw. junge Frau. Später zog sie nach Leipzig, wo sie als „Kartenabreißer“ in einem Kino und in einer Schokoladenfabrik arbeitete. Schließlich fand sie Anstellung in einem Leipziger Restaurant, in dem sie als Kellnerin gekleidet tätig sein durfte.
1916 wurde Richter zum Kriegsdienst eingezogen, jedoch schon nach zwei Wochen wieder aus der Armee entlassen. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs zog sie vorübergehend in ihren Heimatort zurück, meldete sich aber, ermutigt durch einen Freund, bald im Berliner Institut für Sexualwissenschaft, wo sie wohl ab Mai 1923 als Hausmädchen und Küchenhilfe lebte. Hier arbeitete sie zeitweise mit der Malerin Toni Ebel zusammen, die sich um 1930 ebenfalls geschlechtsangleichenden Operationen unterzog. Von ihr wie den anderen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Magnus Hirschfelds am Institut ließ sich Dora Richter liebevoll „Dorchen“ nennen.
Spätestens 1931 wechselte Dora Richter dann als Küchenmädchen in das Restaurant Kempinski am Bertliner Kurfürstendamm. Über ihren späteren Lebensweg ist nichts bekannt. Lediglich ihre Freundin Charlotte Charlaque, die wie Richter und Ebel um 1930 ihre körperliche Geschlechtsangleichung im Umfeld des Instituts für Sexualwissenschaft vollzog, behauptete 1955 einmal, Dora Richter sei – vermutlich nach der Machtübergabe an die Nationalsozialisten in Deutschland – als Köchin in ihre böhmische Heimat zurückgekehrt, wo sie ein Restaurant eröffnete. Charlotte Charlaque bediente sich dabei des Pseudonyms „Carlotta Baronin von Curtius“.
In der Geschichte der Transsexualität gilt Dora Richter heute als erster namentlich bekannter Fall geschlechtsangleichender Operationen. Die chirurgischen Eingriffe, denen Richter sich unterzog, erstreckten sich über den Zeitraum Mai 1923 bis Mai 1931. Ihre Operateure waren unter anderem die Ärzte Heinrich Stabel, Ludwig Levy-Lenz (1892–1966) und Erwin Gohrbandt (1890–1965).
Weiterführende Literatur
Abraham, Felix (1931): Genitalumwandlung an zwei männlichen Transvestiten. In: Zeitschrift für Sexualwissenschaft und Sexualpolitik (Jg. 18), Nr. 4, S. 223-226.
Anonym (1933): Operative Umwandlung von Männern in Frauen gelungen. Die Erfahrungen aus drei Berliner Fällen. In: Die Geburtenregelung (Jg. 1), Nr. 4, S. 33.
Curtius, Carlotta Baronin von (1955): Reflections on the Christine Jorgenson Case, in: One. The Homosexual Magazine (Jg. 3), Nr. 3, S. 27-28.
Hartmann, Clara (2023): Neue Unterlagen zu Dora Richter gefunden, in: Mitteilungen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft Nr. 71/72, S. 32.
Herrn, Rainer (2005): Schnittmuster des Geschlechts. Transvestitismus und Transsexualität in der frühen Sexualwissenschaft (Beiträge zur Sexualforschung, 85). Gießen: Psychosozial-Verlag, S. 201-203.
Holz, Werner (1924): Kasuistischer Beitrag zum sog. Transvestitismus (erotischer Verkleidungstrieb). Med. Diss. Friedrich-Wilhelms-Universität, Berlin.
Najac, Pierre (1931): L’Institut de la Science Sexuelle à Berlin. In: Merlet, Janine (Hrsg.): Vénus et Mercure. Unter Mitarbeit von Gabriel de Reuillard, Henri Drouin u.a. Paris: Editions de la Vie Moderne, S. 165-192.
Noffke, Oliver (2023): Was wurde aus Dora? Dora Richter war die erste Person, die eine vollständige Geschlechtsangleichung erfahren hat. Ihr Weg als Patientin ist gut dokumentiert. Wer sie war, ist hingegen weitestgehend unklar. Ihre Spur verwischt vor 90 Jahren in Berlin. Berlin. Online hier.
Riedel, Samantha (2022): Remembering Dora Richter, One of the First Women to Receive Gender-Affirming Surgery. Her life story – and the reason we know so little about her – is a chilling reminder of what’s at stake when the far right attacks us today. Online hier.
Thomasy, Hannah (2022): A Rose for Dora Richter, online auf: proto – Massachusets General Hospital. Dispatches from the Frontiers of Medicine.
Wolfert, Raimund (2022): Charlotte Charlaque. Transfrau, Laienschauspielerin, „Königin der Brooklyn Heights Promenade“. Berlin, Leipzig: Hentrich & Hentrich.
Riese, Hertha (Dr. med., Psychiaterin, Frauenrechtlerin) geb. 15.3.1892 (Berlin) – gest. 25.11.1981 (Glen Allen, Virginia, USA)
Zur Biografie


Hertha Riese machte sich ab Ende 1924 vor allem als Leiterin der Sozial- und Beratungsstelle des Frankfurter Bundes für Mutterschutz einen Namen. Anschließend war sie bis 1933 als niedergelassene Ärztin in Frankfurt/Main tätig. Sie prangerte wiederholt die elenden Wohn- und Lebensverhältnisse für Frauen der Arbeiterklasse an, verlangte, dass diesen Frauen das Wissen um Verhütungsmethoden nicht länger vorenthalten werde, und argumentierte dafür, dass die soziale Indikation zum Schwangerschaftsabbruch berechtigen müsse. Unterstützt wurde Hertha Riese in der Beratungsstelle durch Lotte Fink (1898–nach 1955), die wie sie selbst Ärztin war. Finanziell gefördert wurde die Beratungsstelle ab Ende der 1920 Jahre auch durch die US-amerikanische Sexualreformerin und Frauenrechtlerin Margaret Sanger.
Hertha Riese nahm zusammen mit ihrem Mann Walter Riese ab etwa 1924 an so gut wie allen internationalen Kongressen teil, die sich mit Fragen der Sexualität, Geburtenregelung und Bevölkerungspolitik befassten. Auf dem Züricher Kongress für Geburtenregelung etwa berichtete sie 1930, sie habe in ihrer Zeit an der Frankfurter Beratungsstelle über 400 Fälle von „Sterilisationen“ beobachten können. Hertha Riese hob dabei hervor, der Eingriff habe positive gesundheitliche Auswirkungen auf die sterilisierten Frauen gehabt.
Zusammen mit ihrem Mann sowie mit Paul und Maria Krische gehörte Hertha Riese auch dem Arbeitsausschuss der Weltliga für Sexualreform (WLSR) an, deren Kopenhagener Prozess sie mit vorbereitete. Über den Kongress berichtete sie ausführlich in mehreren deutschsprachigen Zeitschriften, und zusammen mit dem dänischen Arzt Jonathan Høegh von Leunbach (1884–1955) gab sie 1929 den entsprechenden Kongressbericht heraus.
Als Jüdin musste Hertha Riese 1933 aus Deutschland emigrieren. Zuvor war ihr als Ärztin die Kassenzulassung entzogen worden, und zusammen mit ihrem Mann wurde sie Ende Februar 1933 vorübergehend in einem Frankfurter Gefängnis in „Schutzhaft“ genommen. Die Familie Riese flüchtete daraufhin unter Zurücklassung ihrer gesamten Habe über die Schweiz zunächst nach Frankreich und 1940 von dort weiter in die USA. Hertha Riese blieb in der Emigration für lange Zeit eine erneute medizinisch-therapeutische Arbeit verwehrt. Erst 1942 konnte sie in einer Einrichtung für „delinquent negroes“ im US-amerikanischen Richmond wieder Fuß fassen.
Hertha Riese nahm wie ihr Mann 1947 die amerikanische Staatsbürgerschaft an. Noch Mitte der 1960er Jahre arbeitete sie in einem katholischen Heim für elternlose Kinder, und auch nach ihrer Pensionierung war sie als Beraterin und behandelnde Psychiaterin an verschiedenen Institutionen tätig. Hertha Riese starb am 25. November 1981 in Glen Allen, Virginia (USA).
Nachlass
Der Nachlass von Hertha (und Walter) Riese wird heute in der VCU Health Sciences Library in Richmond/Virginia verwahrt, ein Bestandsverzeichnis findet sich hier.
Schriften (Auswahl)
Riese, Hertha (1927): Die sexuelle Not unserer Zeit (Prometheus-Bücher). Leipzig: Hesse & Becker.
Riese, Hertha (1928): Der internationale Kongreß in Kopenhagen der Weltliga für Sexualreform (W.L.S.R.). In: Zeitschrift für Sexualwissenschaft und Sexualpolitik (Jg. 15), Nr. 5, S. 337-348.
Riese, Hertha (1929): Germany. In: International Medical Group for the Investigation of Birth Control. London: The Hon. Mrs. M. Farrer, S. 12-14.
Riese, Hertha (1929): Die wahren Aufgaben der Sexualberatungsstellen, in: Die Aufklärung (Jg. 1), Nr. 1, S. 6-8.
Riese, Hertha und Jonathan Høegh von Leunbach. Hrsg. (1929): Sexual Reform Congress. W.L.S.R. World League for Sexual Reform. Proceedings of the Second Congress. Copenhagen, 1–5 July 1928. Kopenhagen, Leipzig: Levin & Munksgaard, Georg Thieme Verlag.
Riese, Hertha (1930): Das Sexualleben des Trinkers und seine Familie, in: Die Volksgesundheit (Jg. 40), Nr. 12, S. 274-278.
Riese, Hertha (1932): Geschlechtsleben und Gesundheit, Gesittung und Gesetz. Berlin: Sturm-Verlag.
Riese, Hertha (1962): Heal the Hurt Child. An Approach through Educational Therapy with Special Reference to the Extremly Deprived Negro Child. Chicago: University of Chicago Press.
Quellen und weiterführende Literatur
Grossmann, Atina (1995): Reforming Sex. The German Movement for Birth Control and Abortion Reform, 1920–1950. New York, Oxford: Oxford University Press.
Institut für Geschichte der Medizin und Ethik in der Medizin, Charité (2015): Riese, Hertha [Biografischer Eintrag auf „Ärztinnen im Kaiserreich“], online hier.
Kühl, Richard (2009): Hertha Riese, in: Sigusch, Volkmar und Günter Grau (Hrsg.): Personenlexikon der Sexualforschung. Frankfurt am Main, New York: Campus, S. 591-593.
Linnemann, Dorothee (2014): Hertha Riese, geb. Pataky (1892–1981), auf:Frankfurter Frauenzimmer.
Wolfert, Raimund (2023): Riese, Hertha, in: Frankfurter Personenlexikon.
Rodríguez, Hildegart (Autorin, Sexualreformerin) geb. 9.12.1914 (Madrid, Spanien) – gest. 9.6.1933 (Madrid, Spanien)
Zur Biografie


Bereits im Alter von elf Jahren schrieb Hildegart Rodríguez ihre ersten Aufsätze für die Zeitschrift Sexualidad und hielt öffentliche Reden. Wenige Jahre später sorgte sie mit Artikeln in der Zeitung El Socialista für Aufsehen. Im Alter von vierzehn Jahren wurde sie zur Sprecherin, später zur Vizesekretärin der Weltliga für Sexualreform (WLSR) gewählt. Für die Zeitschrift Sexus der WLSR verfasste sie eigene Beiträge, übersetzte fremdsprachige Artikel ins Spanische und interviewte zentrale internationale Sexualreformer wie Magnus Hirschfeld und Norman Haire (1892–1952).
Als Hildegart Rodríguez im Alter von siebzehn Jahren ihr erstes Studium beendete, war sie nicht nur eine der wenigen weiblichen Akademikerinnen Spaniens, sondern gleichzeitig auch die jüngste Juristin des Landes. Da sie aufgrund ihres Alters noch nicht als Anwältin praktizieren durfte, schrieb sie sich anschließend für ein Medizinstudium ein.
Hildegart Rodríguez veröffentlichte sechzehn Bücher und über 150 Zeitungs- und Zeitschriftenartikel, in denen sie sich mit der Sexualreform und dem Sozialismus auseinandersetzte. Ihre Schriften richteten sich an ein breites Publikum, an Fachleute wie an einfache Arbeiterinnern und Arbeiter, und sie wurden zum Teil bis in die 1980er Jahre hinein wieder aufgelegt. Die Publikationen basierten indes nicht auf eigenen Studien, sondern waren größtenteils Kopien von Arbeiten zeitgenössischer Sexualwissenschaftler (ohne dass dies immer angegeben war) und popularisierten sie.
Laut Hildegart Rodríguez könne nur die freie Liebe Männern wie Frauen ein erfülltes Liebesleben ermöglichen. Prostitution, Ehebruch und „Eifersuchtsdramen“ würden von selbst verschwinden, wenn alle Menschen ihre Bedürfnisse frei und freiwillig befriedigen könnten, war sie überzeugt. Homosexualität hielt Hildegart Rodríguez allerdings für krankhaft und gesellschaftsschädigend.
Aber auch wenn Hildegart Rodríguez die freie Liebe für Männer wie Frauen gleichermaßen einforderte, legte sie in ihren Schriften eine erstaunliche Misogynie an den Tag. Wiederholt verwendete sie distanzierend-herablassende Begriffe wie „mujercita” oder „muchachita”, die gleichbedeutend etwa mit „diese Fräulein“ sind. Gleichzeitig schrieb sie sich in einen Diskurs ein, der die Mutterschaft als die eigentliche Aufgabe von Frauen definierte. „Mutter“ war für Hildegart Rodríguez ein „glorreicher“ Titel, den Frauen sich erwerben mussten. Bildung etwa verstand sie nicht primär als Recht von Frauen, sondern als ein „Gut“, das Frauen an ihre Kinder weitergeben müssten. Frauen sollten innerhalb des von Hildegart Rodríguez propagierten patriarchalen Diskurses „die Nation“ sowohl physisch als auch ideologisch reproduzieren. Zudem, so Hildegart Rodrígeuz, kam Frauen eine besondere Verantwortung zu. Denn keine Frau habe das Recht, die Gesellschaft mit „Degenerierten, Kranken und Verrückten” zu belasten.
Der britische Sexualforscher Havelock Ellis (1859–1939) machte Hildegart Rodríguez weit über die Grenzen Spaniens hinaus bekannt, indem er ihr den Beinamen „die Rote Jungfrau“ gab. Die Bezeichnung fasst all die Merkmale zusammen, die in der Öffentlichkeit als charakteristisch für Hildegart Rodríguez galten: ihr „zartes“ Alter, ihre politische Überzeugung und ihre eigene sexuelle Unschuld. Hildegart Rodríguez stellte zwar in der Öffentlichkeit radikale Forderungen nach freier weiblicher Sexualität, lebte jedoch gleichzeitig Keuschheit und Gehorsamkeit vor – wenn auch vornehmlich ihrer eigenen Mutter und nicht einem Mann gegenüber.
Hildegart Rodríguez wurde am 9. Juni 1933 im Alter von achtzehn Jahren von ihrer Mutter im Schlaf erschossen. Aurora Rodríguez Carballeira, Hildegart Rodríguez’ Mutter, wurde nach dem Mord an ihrer Tochter inhaftiert, sie beendete ihr Leben 1955 in einer psychiatrischen Anstalt.
Weiterführende Literatur (Auswahl)
Sexus. Liga española para la reforma sexual sobre bases científicas (1932). Madrid.
Sinclair, Alison (2003): The World League for Sexual Reform in Spain: Founding, Infighting, and the Role of Hildegart Rodríguez. In: Journal of the History of Sexuality (Jg. 12), Nr. 1, S. 98-109.
Sinclair, Alison (2007): Sex and Society in Early Twentieth-Century Spain. Hildegart Rodríguez and the World League for Sexual Reform. Cardiff: University of Wales Press.
Tarnowsky, Benjamín (1932): Perversiones sexuales. El instinto sexual y sus manifestaciones mórbidas. Traducción, introduccioón y láminas de la señorita Hildegart; Epílogo del doctor Havelock Ellis. Valencia: Biblioteca Cuadernos de Cultura.
Wittenzellner, Jana (2017): Zur Gleichberechtigung durch Misogynie? Widersprüchliche Positionierungen der Sexualreformerin Hildegart Rodríguez. In: Mitteilungen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft, Nr. 57, S. 30-37.
Wittenzellner, Jana (2017): Zwischen Aufklärung und Propaganda. Strategische Wissenspopularisierung im Werk der spanischen Sexualreformerin Hildegart Rodríguez (1914–1933). Bielefeld: transcript Verlag.
Roellig, Ruth (Schriftstellerin) geb. 14.12.1878 (Schwiebus, heute Świebodzin, Polen) – gest. 31.7.1969 (Berlin)
Zur Biografie
Ruth (Margarete) Roellig wurde am 14. Dezember 1878 als Tochter des Gastwirts Otto Roellig und dessen Frau Anna im schlesischen Schwiebus (heute Świebodzin, Polen) geboren. Sie hatte mindestens eine jüngere Schwester. 1887 zog die Familie nach Berlin, wo Ruth Roellig eine Höhere-Töchter-Schule besuchte. Anschließend widmete sie sich privaten Studien und ließ sich zur Redakteurin ausbilden. In ihrer Frühzeit schrieb sie vornehmlich Gedichte, unter anderem für den Berliner Lokalanzeiger und die Zeitschrift Bazar, später schrieb sie auch Kurzgeschichten für die Frauenliebe, die 1930 in die Zeitschrift Garçonne einging.
Ruth Roelligs erstes Buch, Geflüster im Dunkeln, erschien 1913. Es folgten mehrere Prosabände und Romane, die zum Teil im Zirkus- und Theatermilieu angesiedelt sind. Der 1931 erschienene Roman Kette im Schoß schildert die Geschehnisse um ein in Berlin lebendes Geschwisterpaar persischer Herkunft.
1928 erschien Ruth Roelligs Berliner Stadtführer der besonderen Art. Der Titel des Buches lautete Berlins lesbische Frauen. In ihm beschrieb Roellig vierzehn Berliner Clubs und Bars „der Frauenwelt“, unter ihnen der mondäne Club „Mali und Igel“, die „Taverne“ am Alexanderplatz und das „Eldorado“ im Westen Berlins. Das Buch erschien schon 1930 in einer zweiten Auflage, und es wurde auch später, ab den 1980er Jahren, mehrfach neu aufgelegt.
Lesbische Frauen wurden um 1930 in Deutschland nicht strafrechtlich verfolgt, sie sahen sich aber besonders starker gesellschaftlicher Ächtung ausgesetzt. Roellig hielt in ihrem Buch fest: „Lesbische Frauen sind weder Kranke noch Minderwertige – lesbische Frauen sind zwar andersartige, aber den normalen völlig gleichwertige Geschöpfe.“
Diese Auffassung spiegelte auch Magnus Hirschfeld in seinem knappen Vorwort für Berlins lesbische Frauen wider, wenn er schrieb, Roelligs Buch handele von „Frauen, die ebensowenig als krank, minderwertig, wie unsittlich oder gar als verbrecherisch anzusehen sind.“ Im Übrigen lesen sich seine Ausführungen aus heutiger Sicht aber etwas befremdlich. Hirschfeld behauptete, homosexuelle Menschen seien „zur Gründung einer Familie nicht geeignet“, denn sie liefen stets „Gefahr einer Zerrüttung des ehelichen Verhältnisses durch Geistes- oder Nervenstörungen aller Art“; angesichts „ihres schweren Geschicks“ blieben sie „als Geschlechtswesen besser unter sich“.
Bedacht werden muss indes, dass Magnus Hirschfeld dieses Vorwort zu einer Zeit schrieb, als ihm die Vorstellung einer gleichgeschlechtlichen Ehe mit oder ohne Kinder gar nicht in den Sinn kam oder ganz und gar utopisch erscheinen musste. Immerhin hatte er aber 1928 von einer noch gut dreißig Jahre zuvor von ihm vertretenen, überholten These Abschied genommen. 1896 hatte Hirschfeld in Sappho und Sokrates oder Wie erklärt sich die Liebe der Männer und Frauen zu Personen des eigenen Geschlechts? über lesbische Frauen in einer gemischtgeschlechtlichen Ehe geschrieben: „Die homosexuellen Frauen – und ihre Zahl ist Legion – führen fast stets eine glückliche Ehe, die freilich im Grunde nur eine ruhige leidenschaftslose Freundschaft ist.“ Jetzt räumte Hirschfeld ein, „so manches unglückliche Ehebündnis zwischen einem normalen Mann und einer lesbischen Frau wäre nicht oder doch unter ganz anderen Voraussetzungen geschlossen worden, wenn die Partner über ihre gegenseitigen Neigungen aufgeklärt gewesen wären.“
Ruth Roellig lebte über dreißig Jahre mit ihrer Partnerin Erika (Nachname unbekannt) zusammen, die etwa vierzig Jahre jünger als sie selbst war. Erika war Fremdsprachenkorrespondentin bei der Reichsbank. Das Paar lebte zunächst in der Goltzstraße 35 in Schöneberg, und später in der Lützowstraße 85 b in Tiergarten. Aus Anlass einer Denunziation in den späten 1930er Jahren gab Ruth Roellig ihre Freundin Erika als ihre Pflegetochter aus.
Nach der Machtübergabe an die Nationalsozialisten 1933 war Ruth Roellig zeitweise arbeitslos und lebte von Wohlfahrtsunterstützung. Sie interessierte sich für Spiritismus und Okkultismus und hielt als Haustier einen Affen. Von ihr erschienen noch 1935 der Kriminalroman Der Andere und 1937 der vermeintliche „Tatsachenbericht“ Soldaten, Tod, Tänzerin, in dem sie ein „Loblied auf die deutsche Heimatliebe“ sang, das nicht nur antirussische, sondern auch antisemitische Stereotypen bediente und durchaus im Sinne der herrschenden NS-Ideologie war. Die Handlung von Soldaten, Tod, Tänzerin spielte zu großen Teilen in Rumänien, und das rumänische Verkehrsamt beanstandete 1938 gar die Publikation, da man durch sie das rumänische Volk herabgewürdigt sah. Das Propagandaministerium in Berlin sah aber keine Veranlassung, Schritte gegen Roellig und die Veröffentlichung zu unternehmen.
Ruth Roellig bemühte sich 1936 um die Aufnahme in die Reichsschrifttumskammer (RSK), was eine Vorbedingung für schriftstellerische Veröffentlichungen im „Dritten Reich“ war. In ihrem Antrag betonte sie, sie sei „ein durch und durch deutsch fühlender Mensch und bringe den Bestrebungen unseres verehrten Führers die innigsten Sympathien entgegen.“ Ihr Buch Berlins lesbische Frauen wurde gleichwohl 1938 auf die „Liste des schädlichen und unerwünschten Schrifttums“ gesetzt, und fortan erschienen keine weiteren Bücher mehr von ihr.
Nachdem ihre Wohnung Ende 1943 bei einem Luftangriff auf Berlin zerstört worden war, zog Ruth Roellig vorübergehend nach Schlesien. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kehrte sie nach Berlin-Schöneberg zurück, wo sie von Sozialunterstützung lebte. Ruth Roellig starb am 31. Juli 1969.
Schriften (Auswahl)
Roellig, Ruth (1919): Traumfahrt. Eine Geschichte aus Finnland. Eisleben: Probst.
Roellig, Ruth (1928): Berlins lesbische Frauen. Leipzig: Bruno Gebauer Verlag für Kulturprobleme.
Roellig, Ruth (1930): Ich klage an. Berlin: Bergmann-Verlag online hier.
Roellig, Ruth (1930): Lesbierinnen und Transvestiten, in: Esterházy, Gräfin Agnes (Hrsg.): Das lasterhafte Weib. Wien: Verlag für Kulturforschung, S. 67-81.
Roellig, Ruth (1937): Soldaten, Tod, Tänzerin. Gütersloh: Bertelsmann.
Roellig, Ruth Margarete (1996): Lesbierinnen. In: Ariadne. Almanach des Archivs der deutschen Frauenbewegung, Nr. 29, S. 46-47 (auszugsweiser Nachdruck).
Weiterführende Literatur
Hirschfeld, Magnus (1928): Vorwort. Nachdruck in: Meyer, Adele. Hrsg. (1994): Lila Nächte. Die Damenklubs im Berlin der Zwanziger Jahre. Berlin: Edition Lit. Europe, S. 11.
Kokula, Ilse (1994): Lesbisch leben von Weimar bis zur Nachkriegszeit, in: Meyer, Adele. Hrsg. (1994): Lila Nächte. Die Damenklubs im Berlin der Zwanziger Jahre. Berlin: Edition Lit. Europe, S. 101-123.
Ramien, Th. [d. i. Hirschfeld, Magnus] (1896): Sappho und Sokrates oder Wie erklärt sich die Liebe der Männer und Frauen zu Personen des eigenen Geschlechts? Leipzig: Max Spohr online hier.
Schoppmann, Claudia (1996): Die innigsten Sympathien für den Führer. Ruth Margarete Roellig im „Dritten Reich“. In: Christiane Caemmerer und Walter Delabar (Hrsg.): Dichtung im Dritten Reich? Zur Literatur in Deutschland 1933–1945. Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 169-176.
Schoppmann, Claudia (1998): Zeit der Maskierung. Lebensgeschichten lesbischer Frauen im „Dritten Reich“. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, S. 146-158 (erstmals erschienen 1993).
Sanger, Margaret (Sexualreformerin) geb. 15.9.1879 (Corning, New York, USA) – gest. 6.9.1966 (Tucson, Arizona, USA)
Zur Biografie


Als ihre Mutter im Alter von 49 Jahren starb, machte Margaret Higgins den Kinderreichtum ihrer Eltern für den frühen Tod der Mutter verantwortlich. Sie empörte sich ebenso darüber, dass ihre älteren Schwestern große Opfer bringen mussten, um die Familie zu unterstützen. Als ihr Vater, den Margaret Higgins liebte, von ihr verlangte, sie solle den Platz ihrer Mutter im Familienhaushalt übernehmen, verließ sie ihre Familie und ging nach New York, wo sie eine Krankenpflegeschule besuchte.
1902 lernte Margaret Higgins den Architekten William Sanger (1873–1961) kennen, der gebürtig aus Berlin stammte, und ging mit ihm die Ehe ein. Sie wurde Mutter dreier Kinder, fühlte sich in ihrer Rolle als traditionelle Hausfrau und Mutter aber nicht wohl. Sie engagierte sich in der Organisation „International Workers of the World“ und bewunderte Emma Goldman, die sich öffentlich für das Recht der Frau auf Kontrolle ihrer eigenen Sexualität und Fruchtbarkeit einsetzte. Bald war Margaret Sanger eine in den USA weithin bekannte Sexualreformerin, vor allem auch im Zuge ihrer Veröffentlichungen in der US-amerikanischen Tagespresse.
Als die US-Post sich weigerte, Publikationen mit Artikeln Sangers zu befördern, weil es ihr laut Gesetz verboten sei, „sexuelles Material“ zu verbreiten, und Sanger sich mit Schäden auseinandersetzte, die Frauen durch wiederholte Geburten und durch selbst herbeigeführte Schwangerschaftsabbrüche erlitten, entschied sich Sanger, sich fortan ganz der Bewegung zur Empfängnisverhütung zu widmen. Sie trennte sich von ihrem Mann und richtete schließlich ein Netz von Beratungsstellen in den USA ein, in denen Frauen zuverlässige Informationen über Möglichkeiten zur Empfängnisverhütung erhalten konnten. Mehrmals war Margaret Sanger von Verfolgung durch die Polizei und Staatsanwaltschaft bedroht, der sie sich unter anderem durch Flucht nach Europa entzog. Auf dieser Reise lernte sie den britischen Sexualreformer Havelock Ellis (1859–1939) kennen und freundete sich mit ihm an.
Ausgestattet mit einem Empfehlungsschreiben Ellis‘ besuchte Margaret Sanger am 1. September 1920 Magnus Hirschfeld im neu gegründeten Institut für Sexualwissenschaft. Sanger zeigte sich von dem Gebäude, seiner Einrichtung und von Hirschfeld selbst beeindruckt. Sie befand, er sei über das Thema Empfängnisverhütung gut orientiert und stehe ihrer Arbeit aufgeschlossen gegenüber. Gleichwohl konnte sie später über das Institut festhalten: „Es war kein Ort, den ich besonders mochte.” Sanger bat Hirschfeld auch um die Adresse einer deutschen Firma, die ein gewisses chemisches Verhütungsmittel herstellte, von dem sie 1914 zum ersten Mal erfahren hatte. Das Gelee, so hieß es, sei hundertprozentig wirksam und von der deutschen Regierung offiziell zugelassen. Hirschfeld gab Sanger eine Adresse in Dresden, die sich indes als falsch erwies. Als Margaret Sanger nach Dresden fuhr und sich dort und andernorts nach dem Gelee erkundigte, wusste niemand etwas von dessen Existenz.
1916 hatte Margaret Sanger zusammen mit einer ihrer Schwestern eine Klinik in Brooklyn gegründet, in der sie zehn Tage lang knapp 500 Frauen über Verhütungsmittel beriet, bevor die Polizei die Klinik schloss. Durch ihre Verhaftung wurde Sanger zu einer national bekannten Persönlichkeit, und sie erreichte mit der Zeit, dass in den USA Kliniken zur Geburtenkontrolle mit ärztlichem Personal eingerichtet werden konnten.
Indem Margaret Sanger ihre eigene radikale Vergangenheit herunterspielte und fortan eugenische Argumente für die Geburtenkontrolle anstelle von feministischen zu verwenden, gewann sie zunehmend die Unterstützung von Ärzten und Politikern. 1921 gründete sie die „American Birth Control League“, die 1942 in die „Planned Parenthood Federation of America“ umgewandelt wurde. 1923 eröffnete Sanger mit Hilfe ihres zweiten Ehemanns, eines Millionärs, die erste von Ärzten geleitete Verhütungsklinik in den USA, an der später auch Sidonie Fürst als Assistentin tätig wurde. 1925 konnte Sanger einen früheren Freund überzeugen, eine Firma zu gründen, um das erste Diaphragma der USA zu produzieren. Im Zuge mehrerer Gerichtsprozesse, die Sanger zusammen mit ihren Unterstützern anstrengte, entschied die American Medical Association 1937, dass die Empfängnisverhütung fortan als legitime medizinische Dienstleistung und als Bestandteil der ärztlichen Ausbildung anzuerkennen sei.
1952 unterstützte Sanger die Gründung der „International Planned Parenthood Federation“, deren erste Präsidentin sie wurde. In dieser Zeit gelang es ihr ebenfalls, die Philanthropin Katharine Dexter McCormick (1875–1967) dafür zu gewinnen, die Entwicklung der Antibabypille durch Gregory Pincus (1903–1967) finanziell zu fördern.
Margaret Sanger starb am 6. September 1966 in Tucson, Arizona, an Herzversagen.
Margaret Sanger war und ist eine kontroverse Figur. Einerseits wurde sie für ihren Einsatz für die Geburtenkontrolle gefeiert und zur Ikone stilisiert. Das Time Magazin ernannte sie 1999 zu einer der hundert wichtigsten Persönlichkeiten des Zwanzigsten Jahrhunderts, und der Bürgerrechtler Martin Luther King (1929–1968) verglich ihre Arbeit einmal mit seinem eigenen Kampf. Andererseits wurde und wird Margaret Sanger insbesondere aus Kreisen der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung wegen ihrer Verbindungen mit Eugenikern und Rassisten scharf kritisiert. Angela Davis (*1944) etwa behauptete, dass es Margaret Sanger seinerzeit nicht um die selbstbestimmte Empfängnisverhütung von schwarzen Müttern gegangen sei, sondern darum, den Anteil von Schwarzen an der US-amerikanischen Bevölkerung zu minimieren.
Schriften (Auswahl)
Sanger, Margaret (1927): Die neue Mutterschaft. Geburtenregelung als Kulturproblem. Mit einer Einleitung von Adele Schreiber. Dresden: Sibyllen-Verlag.
Sanger, Margaret (1929): Zwangs-Mutterschaft. Vorbemerkung „Zur Lage” von Friedrich Wolf. Stuttgart, Berlin, Leipzig: Deutsche Verlags-Anstalt.
Sanger, Margaret (1978): An Autobiography. New York: Norton.
Weiterführende Literatur und Archivalien (Auswahl)
Anonym (1928): Geburtenkontrolle [Ausführungen zu einem Vortrag von Margret Sanger im Berliner Ärztinnenverein], in: Die Ehe (Jg. 3), Nr. 2, S. 33-34.
Anonym (2012): Sanger’s Hunger Games. A Post-War German Odyssey, in: The Newsletter, Nr. 61, online hier.
Herrn, Rainer (2022): Der Liebe und dem Leid. Das Institut für Sexualwissenschaft 1919–1933. Berlin: Suhrkamp, S. 227.
Margaret Sanger Papers, 1761–1995. Finding aid prepared by Peter Engleman (2003), online hier.
Sappho (Dichterin) geb. um 612 v. u. Z. (Lesbos, Griechenland) – gest. um 570 v. u. Z. (Lesbos, Griechenland)
Zur Biografie


Es heißt, Sappho habe eine Tochter namens Kleis gehabt. Möglicherweise handelte es sich aber auch um eine Geliebte. Die Zeilen in einem Ich-Gedicht Sapphos lassen sich unterschiedlich deuten: „Hab ein schönes Kind, / goldenen Blumen wohl vergleichbar / ist sein feiner Wuchs: / Kleis heißt sie, mein Alles …“
Sappho gilt als geniale Dichterin, deren Werk früheren Autoren weit bekannter war als uns heute. Überliefert sind von ihren Gedichten, in denen die erotische Liebe stets eine hervorragende Rolle spielte, heute nur noch Fragmente. Moderne Schätzungen gehen davon aus, dass nur etwa sieben Prozent ihres Werkes erhalten geblieben sind.
Für Magnus Hirschfeld waren die Gedichte Sapphos vor allem ein Beispiel dafür, dass die Liebe der Frau zur Frau ebenso „dämonisch, stürmisch und aufopferungsfähig” sein könne wie die Liebe zwischen den Geschlechtern. Daraus leitete er aber nicht etwa ein Recht von Frauen ab, untereinander heiraten zu dürfen. Noch 1896 stellte Hirschfeld die Ehe zwischen lesbischen Frauen und (heterosexuellen) Männern nicht in Frage, ja, im Bemühen um Harmonisierung verklärte er sie sogar als in der Regel „glücklich”. Ein besonderes Sensorium für die Bedürfnisse nach weiblicher Selbstbestimmtheit und Selbstentfaltung, innereheliche Konflikte und die im Grunde erniedrigende „Verfügbarmachung” von Frauen und ihrer Arbeitskraft kann ihm dabei nicht attestiert werden.
Magnus Hirschfeld schrieb 1896 in Sappho und Sokrates oder Wie erklärt sich die Liebe der Männer und Frauen zu Personen des eigenen Geschlechts?: „Die homosexuellen Frauen – und ihre Zahl ist Legion – führen fast stets eine glückliche Ehe, die freilich im Grunde nur eine ruhige leidenschaftslose Freundschaft ist. Gegen Verführung gefeit, wohl die Unterhaltung, den Geist, doch nie den Leib des Mannes begehrend, erfüllen sie in stiller Hingabe die häuslichen Pflichten gar wohl im Sinne dessen, was der Schöpfer sprach, als er aus dem Manne das Weib schuf: ‚Eine Gefährtin will ich ihm machen, die um ihn sei’.
In unserer modernen Frauenbewegung steckt unbewußt ein gutes Teil Hermaphroditismus und Homosexualität. Diese mannhaft mutigen Frauen, mit den schönen durchgeistigten Zügen, die man mit Vorliebe interessant zu nennen pflegt, diese Rednerinnen und Schriftstellerinnen, diese gelehrten und philosophierenden Damen mit dem ernsten Auge und der einfachen Kleidung, welche die Ehe oft nur der Tradition willen mögen, wie ringen sie so unermüdlich eifrig für die Rechte der Frau, wie lieben sie ihr zurückgesetztes Geschlecht, dessen Fähigkeiten verallgemeinernd gering zu achten, wie es heute so oft geschieht, eine erstaunliche Unkenntnis verrät.“
In Magnus Hirschfelds Die Homosexualität des Mannes und des Weibes (1914) finden sich zwei lange alphabetische Namenslisten berühmter Homosexueller der Weltgeschichte. Auf der ersten Liste zur griechischen und römischen Antike steht überhaupt kein Name einer Frau, nicht einmal der Sapphos. Die zweite Liste führt „weitere Persönlichkeiten“ auf, doch auch unter ihnen sind nur wenige Frauen, ein Umstand, der Hirschfeld zum Nachdenken über die möglichen Ursachen für die Ungleichheit veranlasste. Hirschfelds Erklärung: Angesichts der von der Gesellschaft vorgegebenen, eingeschränkteren Entwicklungsmöglichkeiten für Frauen als für Männer stehe im Gesamtresultat das „Männlichkeitsplus” von Frauen dem „Weiblichkeitsplus” von Männern in Hinblick auf die „produktive Gestaltungskraft” nach.
Weiterführende Literatur
Dubois, Page (1995): Sappho is Burning. Chicago; London: Chicago University Press.
Giebel, Marion (1980): Sappho in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten (rororo monographie, 291). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
Herzer, Manfred (2017): Magnus Hirschfeld und seine Zeit. Berlin/Boston: De Gruyter, S. 239-240.
Hirschfeld, Magnus (1914): Die Homosexualität des Mannes und des Weibes (Handbuch der gesamten Sexualwissenschaft in Einzeldarstellungen, 3). Berlin: Louis Marcus.
Pusch, Luise F. (o.J.): Sappho, auf Fembio. Frauen.Biographieforschung.
Ramien, Th. [d. i. Hirschfeld, Magnus] (1896): Sappho und Sokrates oder Wie erklärt sich die Liebe der Männer und Frauen zu Personen des eigenen Geschlechts? Leipzig: Max Spohr, S. 26-27 Online hier.
Scheck, Denis (2018): Sappho hat 2600 Jahre Erfahrung in Sachen Erotik, in: Die Welt, 17.5.2018 Online hier.
Stark, Florian (2014): Neue Funde zur Dichterin der lesbischen Liebe, in: Die Welt, 1.2.2014 Online hier.
Schreiber, Adele (Journalistin, Schriftstellerin) geb. 29.4.1872 (Wien, Österreich) – gest. 18.2.1957 (Herrliberg, Schweiz)
Zur Biografie


Adele Schreiber wollte eigentlich wie ihr Vater, der Arzt Joseph Schreiber (1835–1908), Medizin studieren, doch schlugen ihr die Eltern den Wunsch ab. Sie sollte das „Leben eines jungen Mädchens aus gutem Hause“ führen und heiraten. Im Zuge mehrerer Reisen ins europäische Ausland, so nach England, Frankreich und Italien, entschied sie sich schließlich, Schriftstellerin zu werden. Sie ließ sich früh von August Bebels Die Frau und der Sozialismus (1879) begeistern und schrieb Beiträge für Zeitschriften wie Die Neue Zeit, das Wiener Fremdenblatt und die von Clara Zetkin (1857–1933) herausgegebene Die Gleichheit.
1898 zog Adele Schreiber nach Berlin, nachdem sie im Jahr zuvor das Angebot angenommen hatte, hier eine Versicherungsgesellschaft für Frauen aufzubauen. In ihrer Freizeit besuchte sie politische Vorträge und Veranstaltungen, und als sich das Vorhaben einer Versicherungsgesellschaft für Frauen zerschlug, verlegte sie ihre Aktivitäten vollends auf die Publizistik. Ab 1899 hielt sie Vorträge zu Frauenthemen und zu sozialen Fragen, 1906 gab sie Das Buch vom Kinde heraus und 1914 verfasste sie eine Biografie über die Frauenrechtlerin Hedwig Dohm, die sie sehr verehrte. Stark beeindruckt war sie ebenfalls von der französischen Anarchistin Louise Michel, mit der sie persönlich bekannt war.
Adele Schreiber trat der SPD zunächst nicht bei, sondern zählte sich zum radikalen Flügel der Frauenbewegung. Ein Studium der Nationalökonomie an der Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität konnte sie nur als Gasthörerin aufnehmen, da Frauen das Studium in Preußen erst 1908 erlaubt wurde. Schreiber schloss sich dem Kampf gegen die Prostitution an und nahm 1902 am Kongress zur internationalen Bekämpfung des Mädchenhandels in Frankfurt am Main teil. Auf dem Berliner Kongress des Internationalen Frauenrats hielt sie 1904 einen Vortrag über die Alters- und Invalidenversicherung. Im gleichen Jahr wurde sie Mitbegründerin und Vizepräsidentin des Weltbundes für Frauenstimmrecht sowie – zusammen mit Helene Stöcker und anderen – des Berliner Ortsvereins des Bundes für Mutterschutz (BfM). Da sie sich aber bald mit Stöcker entzweite, verließ sie den Bund für Mutterschutz 1909 und gründete im Jahr darauf die Deutsche Gesellschaft für Mutter- und Kindesrecht, die unter anderem von Minna Cauer und Hedwig Dohm unterstützt wurde.
Neben dem Kinder- und Mütterschutz stand die Erlangung des Frauenwahlrechts zentral im Engagement Adele Schreibers. 1909 gab sie die Zeitschrift Frauen-Fortschritt heraus, die allerdings nur bis 1911 erschien. In diesem Jahr forderte Schreiber öffentlich sie eine Mutterschaftsversicherung, und 1912 trat sie der SPD bei. Sie war von 1920 bis 1924 sowie von 1928 bis 1933 sozialdemokratisches Mitglied des Berliner Reichtags. Adele Schreiber gehörte nach der Einführung des allgemeinen Wahlrechts auch für Frauen in Deutschland neben Lou Andreas-Salomé, Louise Dumont, Gertrud Eysoldt, Käthe Kollwitz, Grete Meisel-Hess und Helene Stöcker zu den sieben erstunterzeichnenden Frauen der Petition des Wissenschaftlich-humanitären Komitees (WhK) gegen den § 175 RStGB, der mann-männliche Sexualkontakte mit Strafe belegte.
Bereits am 5. März 1933, dem Tag der Reichstagswahl, emigrierte Adele Schreiber in die Schweiz, und nachdem ihr 1939 die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt worden war, zog sie von hier weiter nach Großbritannien, wo sie Mitglied der Labour Party wurde. 1947 kehrte sie in die Schweiz zurück, wo sie am 18. Februar 1957 im Kanton Zürich verstarb. Adele Schreiber war seit 1909 mit dem praktischen Arzt Dr. Richard Krieger (1880–?) verheiratet, der ihr jedoch nicht in das Schweizer Exil folgte. Bis 1933 führte sie offiziell den Namen Schreiber-Krieger, im Exil legte sie den Zweitnamen jedoch ab. Ob die Ehe zwischen ihr und Richard Krieger je geschieden wurde, ist nicht bekannt.
Würdigungen
Im Berliner Regierungsviertel wurde 2005 eine Straße nach Adele Schreiber-Krieger benannt. An ihrem einstigen Berliner Wohnhaus in der Ahornallee 50, Charlottenburg-Wilmersdorf, erinnert seit 1995 eine Gedenktafel an sie.
Schriften (Auswahl)
Schreiber, Adele (1907): Das Buch vom Kinde. Ein Sammelwerk für die wichtigsten Fragen der Kindheit unter Mitarbeit zahlreicher Fachleute. Leipzig: B. G. Teubner.
Schreiber, Adele (1909): Der Bund für Mutterschutz und seine Gegner. Leipzig: Felix Dietrich.
Schreiber, Adele. Hrsg. (1912): Mutterschaft. Ein Sammelwerk für die Probleme des Weibes als Mutter. Mit einer Einleitung von Lily Braun. München: Langen.
Schreiber, Adele, zusammen mit Anita Augspurg, Hedwig Dohm, Helene Stöcker u.a. (1912): Ehe? zur Reform der sexuellen Moral. Berlin: Internationale Verlagsanstalt für Kunst und Literatur.
Schreiber, Adele (1914): Hedwig Dohm als Vorkämpferin und Vordenkerin neuer Frauenideale. Berlin: Märkische Verlagsanstalt.
Weiterführende Literatur
Bittermann-Willi, Christa (o.J.): Schreiber-Krieger, Adele, auf: Frauen in Bewegung 1848–1938 (Ariadne und Österreichische Nationalbibliothek).
Braune, Asja (2003): Konsequent den unbequemen Weg gegangen – Adele Schreiber (1872–1957). Politikerin, Frauenrechtlerin, Journalistin. Dissertation, Berlin (online hier).
Fischer, Ilse (2007): Schreiber-Krieger, Adele, in: Neue Deutsche Biographie 23, S. 535-536 (Online-Version hier).
Schoppmann, Claudia (2009): Adele Schreiber-Krieger, in: Sigusch, Volkmar und Günter Grau (Hrsg.): Personenlexikon der Sexualforschung. Frankfurt am Main, New York: Campus, S. 636-639.
Wickert, Christl (1992): Sozialistin, Parlamentarierin, Jüdin. Die Beispiele Käthe Frankenthal, Berta Jourdan, Adele Schreiber-Krieger, Toni Sender und Hedwig Wachenheim, in: Heid, Ludger und Arnold Paucker (Hrsg.): Juden und deutsche Arbeiterbewegung bis 1933. Tübingen: Mohr Siebeck.
Schulz, Adelheid (Hauswirtschafterin) geb. 23.4.1909 (Stolp, heute Słupsk, Polen) – gest. 16.10.2008 (Berlin)
Zur Biografie


Ins Institut für Sexualwissenschaft kam Adelheid Rennhack durch eine Berliner Stellenvermittlerin. Als Hauswirtschafterin oblag „Delchen“, wie sie allgemein genannt wurde, unter anderem die Pflege der Empfangs- und Gesellschaftsräume, sie versorgte die im Obergeschoß der Villa untergebrachten Gäste und Patient_innen des Hauses, servierte bei Tisch, verwaltete die Wäsche und das Geschirr und erledigte die nötigen Einkäufe, gelegentlich saß sie auch am Empfang. Durch ihre Tätigkeit war Adelheid Rennhack für viele Patienten im Hause die erste Ansprechpartnerin, für manche wurde sie eine gute Freundin.
Wie die meisten anderen Angestellten wohnte Adelheid Rennhack im Hause. Sie musste allerdings im Laufe der Jahre innerhalb des Instituts fünfmal umziehen. Ganz zuletzt wohnte sie im früheren Labor des Dermatologen Bernhard Schapiro (1885–1966) im zweiten Stock mit Blick auf den Hof – das Zimmer hatte den Vorteil eines Wasser- und Gasanschlusses. Sie erhielt neben Kost und Logis 30 Mark monatlich als Lohn, ihre Arbeitszeit ging von 7 bis 18 Uhr.


Bekannt ist des Weiteren, dass Adelheid Schulz wohl in den 1950er Jahren in Ost-Berlin mindestens einmal die Malerin Toni Ebel besucht hat, die sie um 1930 als Patientin und zeitweilige Mitarbeiterin am Institut für Sexualwissenschaft kennengelernt hatte.
Adelheid Schulz starb fast hundertjährig am 16. Oktober 2008 in Berlin. Sie wurde auf dem Friedhof St. Georgen III in Berlin-Weißensee beigesetzt.
Weiterführende Literatur
Baumgardt, Manfred (2003): Kaffeerunde mit Adelheid Schulz. In: Schwule Geschichte (Nr. 7), S. 4-16.
Dose, Ralf (2021): Haus-, medizinisches und Verwaltungspersonal des Instituts für Sexualwissenschaft. In: Mitteilungen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft, Heft 67, S. 9-32.
Ripa, Alexandra (2004): Hirschfeld privat. Seine Haushälterin erinnert sich. In: Elke-Vera Kotowski und Julius H. Schoeps (Hrsg.): Magnus Hirschfeld. Ein Leben im Spannungsfeld von Wissenschaft, Politik und Gesellschaft (Sifria. Wissenschaftliche Bibliothek, 8). Berlin: be.bra wissenschaft, S. 65-70.
Film
Ripa, Alexandra (2002): Ein ganzes Leben. Adelheid Schulz (Abschlussfilm).
Schurgast, Margarete (Fotografin, Pensionsinhaberin) geb. 3.8.1871 (Berlin) – gest. 7.7.1947 (Cincinatti, Ohio, USA)
Zur Biografie


Margarete Schurgast wurde am 3. August 1871 in eine jüdische Familie in Berlin geboren. Ihr Familienname war Loewy. Sie heiratete vermutlich um 1892 Ludwig Paul Schurgast (1862–1938), der gebürtig aus Breslau (heute Wrocław, Polen) stammte, und wurde Mutter zweier Söhne, die 1893 und 1895 geboren wurden. Möglicherweise war Margarete Schurgast lesbisch. Sie dürfte zeitweise auch an starken Depressionen gelitten haben. Anfang 1905 schrieb Franziska Mann an die schwedische Schriftstellerin und Reformpädagogin Ellen Key, mit der sowohl sie als auch Margarete Schurgast befreundet waren: „Denk nur, die arme Frau Schurgast liebt mich so, daß all ihr Elend zu verblassen anfängt. Ich halte sie aber doch für schwer melancholisch und fürchte, der Trieb in ihr, sich selbst das Leben zu nehmen, wird zuletzt das Stärkste bleiben.“
Anfang des 20. Jahrhunderts scheint sich Margarete Schurgast verstärkt der Fotografie gewidmet zu haben. So ist sie etwa als Schöpferin einer Aufnahme von Franziska Mann (um 1906) und des bereits angesprochenen Porträts von Minna Cauer bekannt. 1905 wurde sie in die „Freie Photographische Vereinigung zu Berlin e.V.“ aufgenommen. Sie war 1907 ebenfalls mit zwei Arbeiten in der Zeitschrift Die Kunst in der Photographie vertreten. Belegt ist des Weiteren, dass Margarete Schurgast im Herbst 1906 mehrmals Rainer Maria Rilke (1875–1926) und dessen Frau Clara Rilke-Westhoff (1878–1954) porträtiert hat.
In Berlin betrieb Margarete Schurgast bis in die 1930er Jahre hinein zwei Gästehäuser, die Pension „Ludwig“ in der Markgrafenstraße 33 (Mitte), die offensichtlich nach ihrem Ehemann benannt war, und die Hotelpension „Kurfürstenheim“ in der Budapester Straße 37 (Charlottenburg). Schurgast war Frauenrechtlerin und Pazifisten, sie war Mitbegründerin des Hilfsvereins für gebildete Frauen und ein aktives Mitglied der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit (Women’s International League for Peace and Freedom, WILPF) sowie der Liga für Menschenrechte. Sie stand Anfang der 1920er Jahre im Austausch mit der US-amerikanischen Feministin Jane Addams (1860–1935), die 1931 den Friedensnobelpreis erhielt, und die Schriftstellerin Anselma Heine (1855–1930) widmete ihr 1925 die „Erzählung aus Goethes Jugendland“ Der Zwergenring.
Als Jüdin gelang Margarete Schurgast noch 1941, drei Jahre nach dem Tod ihres Mannes, die Flucht aus Deutschland in die USA, wo sie sich in Cincinatti, Ohio, niederließ und unter anderem mit der dänischen Schriftstellerin Karin Michaëlis (1872–1950) und der ungarischen Feministin Rosika Schwimmer (1877–1948) noch in Briefkontakt stand.
Nachlass
Ein Teilnachlass Margarete Schurgasts wird heute in der New York Public Library verwahrt, eine Bestandsübersicht findet sich hier. Drei Postkarten von Anna Plothow an Margarete Schurgast sind Teil der Sammlung im Archiv der deutschen Frauenbewegung in Kassel.
Schriften (Auswahl)
Schurgast, Margarete (1926): Ellen Keys testamente. Ett vackert minne av det sista sammanträffandet, in: Idun (Jg. 39), Nr. 21, S. 516.
Weiterführende Literatur
Key, Ellen (1911): Pensionat i världsstäderna, in: Idun (Jg. 24), Nr. 14, S. 214.
Die Kunst in der Photographie 1907 (Jg. 11). Hgg. von Franz Goerke. Erschienen im Verlag Wilhelm Knapp, Halle a. S., Abb. 20 und 31.
Photographische Rundschau und photographisches Centralblatt. Zeitschrift für Freunde der Photographie 1906 (Jg. 20). Hgg. von Dr. Neuhauss, F. Matthies-Masuren und H. Schnauss, [S. 297].
Schnack, Ingeborg (1966): Rilkes Leben und Werk im Bild (2., vermehrte Auflage). Wiesbaden: Insel Verlag, Abb. 153-155.
Wolfert, Raimund (2017): Annäherungen an Franziska Mann – Schriftstellerin und Briefpartnerin Ellen Keys. In: Mitteilungen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft, Heft 58/59, S. 45-64, hier S. 53-54.
Schwabe, Toni (Schriftstellerin) geb. 31.3.1877 (Bad Blankenburg) – gest. 17.10.1951 (Bad Blankenburg)
Zur Biografie


Toni Schwabe litt immer wieder unter einer angegriffenen Gesundheit. Sie schrieb Romane, Erzählungen und Gedichte, übersetzte vornehmlich aus dem Dänischen und veröffentlichte zahlreiche Beiträge in literarischen Zeitschriften wie Arena, Der Orchideengarten, Simplicissimus und Orplid sowie in Anthologien. 1916 gründete sie den Landhausverlag in Jena, und bis 1921 gab sie die Zeitschrift Das Landhaus heraus.
Nach der Trennung von Sophie Hoechstetter lebte sie in Beziehungen mit Elsa von Bonin und Toska Lettow.
1929 begann sie mit dem Bau eines Hauses in ihrer Heimatstadt Bad Blankenburg. In den 1930er Jahren hegte sie gewisse Sympathien für den Nationalsozialismus, arbeitete zeitweise für den Rundfunk, war aber literarisch kaum noch präsent. Nach den verheerenden Bombenangriffen auf Berlin zog sie 1944 ganz nach Bad Blankenburg, doch verschlechterte sich hier ihr Gesundheitszustand zunehmend. Sie war gegen ihr Lebensende völlig mittellos und wiederholt Anfeindungen seitens der Behörden ihrer Heimatstadt ausgesetzt.
Zu Toni Schwabes literarischem Werk gehören der Roman Die Hochzeit der Esther Franzenius (1903), der 2013 erneut aufgelegt wurde, und ihr erster Goethe-Roman Ulrike (1925), der ihr den größten finanziellen Erfolg bescheren sollte.
Schriften (Auswahl)
Schwabe, Toni (1890): Das Weib als halbwüchsiges Mädchen. In: R. Koßmann und Jul Weiß (Hrsg.): Mann und Weib. Ihre Beziehungen zueinander und zum Kulturleben der Gegenwart. I. Band: Der Mann. Das Weib. Stuttgart, Berlin, Leipzig: Union Deutsche Verlagsgesellschaft, S. 321-338.
Schwabe, Toni (1890): Das Weib als Jungfrau. In: R. Koßmann und Jul Weiß (Hrsg.): Mann und Weib. Ihre Beziehungen zueinander und zum Kulturleben der Gegenwart. I. Band: Der Mann. Das Weib. Stuttgart, Berlin, Leipzig: Union Deutsche Verlagsgesellschaft, S. 339-360.
Schwabe, Toni (1906): Bleib jung meine Seele. Berlin: Axel Juncker Verlag.
Schwabe, Toni: Die Hochzeit der Esther Franzenius (Literatinnnen um 1900, 6). Mit einem Nachwort herausgegeben von Jenny Bauer. Hamburg: Igel Verlag 2013.
Weiterführende Literatur
Bauer, Jenny (2016): Geschlechterdiskurse um 1900. Literarische Identitätsentwürfe im Kontext deutsch-skandinavischer Raumproduktion. Bielefeld: transcript Verlag.
Bauer, Jenny (2018): How to Write an Author. Biografische Spurensuche zu Toni Schwabe (1877–1951), in: Initiative Queer Nations (Hrsg.): Jahrbuch Sexualitäten, S. 31-56.
Herzer, Manfred (2017): Magnus Hirschfeld und seine Zeit. Berlin: De Gruyter Oldenbourg, S. 102.
Riebe, Tom. Hrsg. (2016): Toni Schwabe (Verspensporn, 25). Jena: Edition Poesie schmeckt gut e.V.
Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen. Hrsg. (2015): Persönlichkeiten in Berlin 1825–2006. Erinnerungen an Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen. Berlin, S. 70-71.
Selig, Dorothea (Dr. med., Gynäkologin, Kinderärztin) geb. 29.11.1891 (Worms) – gest. 28.10.1969 (Wien, Österreich)
Zur Biografie
Dorothea Selig wurde am 29. November 1891 als jüngste Tochter des jüdischen Arztes und Sanitätsrats Dr. med. Gustav Selig (1854–1919) und dessen Frau Bertha geb. Strauß (1864–1943) in Worms geboren. Ihr Geburtsname war Dora. Sie hatte vier ältere Geschwister, von denen eine Schwester, Paula Selig (1883–1962), ebenfalls Ärztin wurde.
Dorothea Selig besuchte das Großherzoglich Hessische Ernst-Ludwigs-Gymnasium in ihrer Geburtsstadt, das sie 1911 mit dem Zeugnis der Reife verließ. Anschließend studierte sie Medizin in München, Berlin und Heidelberg, wo sie am 4. Juni 1916 das medizinische Staatsexamen bestand. Sie promovierte im Jahr darauf. Ihre medizinische Dissertation legte sie unter dem Titel „Ein Fall von Retinitis exsudativa mit Netzhautablösung, Cholestearinbildung und Verknöcherung der Aderhaut“ vor.
Dorothea Selig praktizierte als Gynäkologin und Kinderärztin und war um 1919 zeitweilig Mitarbeiterin am Institut für Sexualwissenschaft Magnus Hirschfelds in Berlin. In den 1920er und frühen 1930er Jahren betrieb sie eine Praxis in der Berliner Straße 144 in Charlottenburg. Ihre Wohnung hatte sie bis etwa 1937 am Kurfürstendamm 20.
Dorothea Selig galt nach dem Gesetz vom 7. April 1933 als Jüdin, weshalb ihr im selben Jahr die Kassenzulassung entzogen wurde. Über ihr weiteres Schicksal ist nur wenig bekannt. Offenbar hat Dorothea Selig nach 1933 geheiratet. Zusammen mit ihrem Mann Raoul Gustav von Toms (1896–1978), der gebürtig aus Österreich stammte und Polizeioffizier war, gelang es ihr, vor der nationalsozialistischen Verfolgung nach Shanghai (China) zu entkommen. Dort lebte das Ehepaar von Toms noch 1947. Dorothea von Toms wurde in China offenbar als Krankenschwester tätig, Raoul von Toms hielt im Februar 1941 in „Jungmann’s Caféstube“ in der Shanghaier Seward Road einen öffentlichen Vortrag zu Nachbarfragen der Medizin. Er wurde ebenfalls Mitarbeiter der 1939 ins Leben gerufenen und von der amerikanischen Rundfunkstation XMHA ausgestrahlten deutschsprachigen Radiosendung für „jüdische” Flüchtlinge in China. In dieser Eigenschaft kommentierte er regelmäßig das Weltgeschehen vor dem Mikrofon.
1949 zog Dorothea von Toms zusammen mit ihrem Mann vorübergehend zu ihrer Schwester Paula nach Brasilien, von dort aus ging das Ehepaar nach Österreich. Dorothea von Toms starb am 28. Oktober 1969 in Wien-Penzing und wurde am 4. November 1969 auf dem Wiener Friedhof Ober-Sankt-Veit beigesetzt.
Schriften (Auswahl)
Selig, Dorothea (1917): Ein Fall von Retinitis exsudativa mit Netzhautablösung, Cholestearinbildung und Verknöcherung der Aderhaut. Heidelberg, med. Diss.
Toms, Dorothea von (1940): Der neuen Zeitschrift zum Geleite, in: Medizinische Monatshefte Shanghai (Jg. 1), Nr. 1, S. 5.
Weiterführende Literatur und Quellen
Eintrag zu Dorothea Selig in der Dokumentation „Ärztinnen im Kaiserreich“, Institut für Geschichte der Medizin und Ethik in der Medizin, Charité – Universitätsmedizin Berlin, online zugänglich hier.
Herrn, Rainer (2022): Der Liebe und dem Leid. Das Institut für Sexualwissenschaft 1919–1933. Berlin: Suhrkamp, S. 83.
Schmitt-Englert, Barbara (2021): Deutsche in China 1920–1950. Alltagsleben und Veränderungen (Ludwigshafener Schriften zu China, 1). Gossenberg: Ostasien-Verlag, S. 323.
Shanghai Telephone Directory, 1947 online zugänglich hier.
Sterbefallanzeige Bertha Selig, in: Der Aufbau, 16.4.1943, S. 19, online zugänglich hier.
Veranstaltungshinweis zu einem Vortrag von Raoul von Toms, in: Medizinische Monatshefte Shanghai 1942 (Jg. 2), Nr. 1, S. 5, online zugänglich hier.
Sprüngli, Theo Anna (Schriftstellerin, Musikkritikerin) geb. 15.8.1880 (Hamburg) – gest. 8.5.1953 (Delmenhorst)
Zur Biografie


Am 9. Oktober 1904 hielt Theo Anna Sprüngli vor dem Wissenschaftlich-humanitären Komitee (WhK) die vermutlich erste lesbenpolitische Rede im deutschsprachigen Raum. Dabei bediente sich die 24-Jährige des Pseudonyms Anna Rüling, wobei der „Nachname“ eine anagrammatische Variante ihres Namens Sprüngli unter Auslassung des anlautenden „Sp“ ist. Die Rede, in der Sprüngli auf das Verhältnis „homosexueller Frauen“ zur organisierten Frauenbewegung einging und in der sie sich selbst als homosexuell bezeichnete, hielt sie am 27. Oktober 1904 vor dem anarchistischen Bund für Menschenrechte (nicht identisch mit dem Bund für Menschenrecht, BfM) erneut.
Theo Anna Sprüngli wohnte um diese Zeit in Berlin und war für den Scherl-Verlag tätig, in dem unter anderem die Zeitungen Der Tag und Berliner Tagesanzeiger erschienen. Wenige Jahre später zog Theo Anna Sprüngli nach Düsseldorf, wo sie etwa dreißig Jahre wohnen blieb. Sie veröffentlichte 1914 ihren Kurzen Abriss der Musikgeschichte und 1921 das Buch Das deutsche Volkslied.
Theo Anna Sprüngli schrieb in Düsseldorf vorrangig journalistische Beiträge über Musikveranstaltungen, aber sie verfasste auch Reiseberichte und berichtete über die Tätigkeiten frauenpolitischer Organisationen wie dem Rheinischen Frauenklub. Spätere arbeitete sie auch für die Düsseldorfer Lokal-Zeitung und eine Reihe von auswärtigen Blättern wie den Bremer Nachrichten, der Dortmunder Zeitung und den Leipziger Neuesten Nachrichten. Hinweise zum Thema Homosexualität finden sich in dieser Zeit in einem einzigen Artikel. So berichtete Theo Anna Sprüngli im August 1919 in der Neuen Deutschen Frauen-Zeitung über die Gründung des Berliner Instituts für Sexualwissenschaft. Die Leitung hätten Magnus Hirschfeld und „Arthur Herzfeld“, mit dem wohl Arthur Kronfeld gemeint war, übernommen.
In vielen ihrer Texte schlug Theo Anna Sprüngli markige patriotisch-nationalistische Töne an, und ihrem Gesuch um die Aufnahme in den Reichsverband Deutscher Schriftsteller vom 27. November 1933 betonte sie, dass sie „immer in der vordersten Linie für deutsche Kunst gekämpft“ habe. Sie unterzeichnete das Schreiben „mit deutschem Gruß“, Mitglied der NSDAP ist sie aber nie geworden.1937 heißt es in einer Gestapo-Akte, dass in politischer Hinsicht Nachteiliges über Theo Anna Sprüngli nicht bekannt geworden sei. Christiane Leidinger, die sich im deutschsprachigen Raum wohl am eingehendsten mit dem Lebensweg und den Werken der Schriftstellerin beschäftigt hat, bezeichnet Theo Anna Sprüngli als „zwiespältige Ahnin lesbischer herstory“, die sich nicht zur „historisch lesbisch-feministischen Identifikation“ eigne.
Zwischen 1940 und 1943 war Theo Anna Sprüngli am Stadttheater in Ulm beschäftigt, und in dieser Zeit wohnte sie vermutlich im nahegelegenen Blaubeuren. Nach dem Zweiten Weltkrieg war sie zeitweise als Dramaturgin am Stadttheater in Delmenhorst zwischen Bremen und Oldenburg angestellt. Nebenbei arbeitete sie auch als Journalistin, etwa für die Delmenhorster Zeitung und die Nordwestzeitung. Als Theo Anna Sprüngli am 8. Mai 1953 im Alter von 73 Jahren starb, hieß es in einem Nachruf, in dem auch ihre „fast männliche Erscheinung“ hervorgehoben wurde, „Deutschlands älteste Journalistin“ sei gestorben.
Schriften (Auswahl)
Rüling, Anna (1905): Welches Interesse hat die Frauenbewegung an der Lösung des homosexuellen Problems? Eine Rede. Gehalten auf der Jahresversammlung des Wissenschaftlich-humanitären Komitees im Hotel Prinz Albrecht am 8. Oktober 1904. In: Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen 7, S. 131-151. Online verfügbar hier.
Rüling, Th. (1906): Welcher von Euch ohne Sünde ist … Bilder von der Schattenseite. Leipzig: Max Spohr.
Sprüngli, Th. A. (1914): Kurzer Abriss der Musikgeschichte. Köln: P. J. Tonger.
Sprüngli, Th. A. (1919): Institut für Sexualwissenschaft, in: Neue Deutsche Frauen-Zeitung (Nr. 31), 2.8.1919.
Sprüngli, Th. A. (1921): Das deutsche Volkslied (Tonger’s Musikbücherei, 16). Köln: P. J. Tonger.
Weiterführende Literatur
Deine Kollegen (1953): Der Tod entwand ihr die Feder. Deutschlands älteste Journalistin ist nicht mehr – Theodora-Anna Sprüngli, in: Delmenhorster Zeitung, 9.5.1953.
Leidinger, Christiane (2003): Theo A[nna] Sprüngli (1880–1953) alias Anna Rüling/Th. Rüling/Th. A. Rüling – erste biographische Mosaiksteine zu einer zwiespältigen Ahnin lesbischer herstory, in: Mitteilungen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft (Nr. 35/36), S. 25-42.
Leidinger, Christiane (2016): Theo-Anna Sprüngli (1880–1953), besser bekannt als „Anna Rüling“. Berühmte Berliner Rednerin, Kulturjournalistin, Ulmer Schauspielleiterin und Theaterdramaturgin, online auf LSBTTIQ in Baden-Württemberg.
Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen. Hrsg. (2015): Persönlichkeiten in Berlin 1825–2006. Erinnerungen an Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen. Berlin, S. 72-73.
Stöcker, Helene (Dr. phil., Publizistin) geb. 13.11.1869 (Elberfeld) – gest. 24.2.1943 (New York, USA)
Zur Biografie


Helene Stöcker setzte sich für ein demokratisches Frauenwahlrecht, die rechtliche, soziale und ethische Gleichstellung lediger Mütter und ihrer Kinder, die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs und das Recht der Frau auf Empfängnisverhütung ein. Sie vertrat ihre Positionen unter anderem im Bund für Mutterschutz (BfM, ab 1908 Bund für Mutterschutz und Sexualreform) und in der Zeitschrift Die Neue Generation, die von 1908 bis 1933 unter ihrer Schriftleitung erschien. Privat lebte sie ab 1905 mit ihrem Lebensgefährten, dem jüdischen Rechtsanwalt Bruno Springer (?–1931), in einer „modernen” Lebensgemeinschaft zusammen, die kinderlos blieb. Als Springer starb, war er 57 Jahre alt, er dürfte mithin um 1874 geboren sein. Bruno Springer stammte aus Ostrowo (heute Ostrów Wielkopolski, Polen).
Mit Magnus Hirschfeld und dem Wissenschaftlich-humanitären Komitee (WhK) kam Helene Stöcker 1909 in Kontakt, und 1912 trat sie der Vereinigung auch offiziell bei. Im selben Jahr wurde sie in das Obmännerkollegium des WhK gewählt. Aber bereits am 10. Februar 1911 veranstaltete der Bund für Mutterschutz unter dem Vorsitz von Helene Stöcker in Berlin einen Vortragsabend gegen die damals geplante und im Gespräch befindliche Ausdehnung des § 175 RStGB auf die Frauen. Anwesend war neben Magnus Hirschfeld auch der Arzt und spätere Erste Vorsitzende des WhK Heinrich Stabel.
Helene Stöcker war Frauenrechtlerin, Sexualreformerin und Pazifistin. Sie war unter anderem Mitbegründerin der Internationale der Kriegsdienstgegner im niederländischen Bilthoven, Vorstandsmitglied in der Deutschen Liga für Menschenrechte und schloss sich später der Gruppe Revolutionärer Pazifisten Kurt Hillers an. 1929 nahm sie am zweiten Internationalen Kongress für Sexualreform in Kopenhagen teil.
Stöcker kam eine große integrative Kraft zu. Kurt Hiller schrieb nach dem Zweiten Weltkrieg an die befreundete lesbische Berliner Journalistin Eva Siewert (1907–1994): „Die hysterische Tribade mit Männerfeindschaft war fin-de-siècle ein verhältnismäßig verbreiteter Typus, welcher sogar, wegen seiner Komik, einige Popularität genoss, aber doch bereits um 1910, sicher 1920 überwunden war, nicht ohne Hilfe erfreulicher Frauengestalten wie Helene Stöcker, Else Lasker-Schüler oder Renée Sintenis. In den Kreisen des Kartells für Reform des Sexualstrafrechts galt es einfach als schlechter Ton, die Propaganda der Freiheit für androtrope Männer mit Antifeminismus zu verbinden oder die feministische Propaganda mit Feindseligkeiten gegen den Mann.”
1932 begann Helene Stöcker mit der Niederschrift ihrer Memoiren, konnte sie aber unter den herrschenden Umständen bis an ihr Lebensende nicht abschließen. Nach der „Machtübernahme” der Nationalsozialisten verließ sie Deutschland im Frühjahr 1933 und ging ins Exil zunächst nach Zürich. Ende 1938 zog sie von hier weiter nach London. Die Nationalsozialisten hatten sie inzwischen ihrer Staatsbürgerschaft, ihres in Deutschland verbliebenen Vermögens und etlicher Kisten mit wichtigen Manuskripten beraubt. Von Schweden aus bemühte sich Helene Stöcker ab 1939 um die Einreise in die USA, die sie nach einer langen und beschwerlichen Reise über Moskau, Wladiwostok und Japan 1941 schließlich erreichte.
Helene Stöcker starb am 24. Februar 1943 in New York an einem Krebsleiden. Ihre unvollendete Autobiographie konnten Reinhold Lütgemeier-Davin und Kerstin Wolff erst 2015 herausgeben. Unklar ist vor diesem Hintergrund, warum Helene Stöcker in ihren Lebenserinnerungen ihre langjährige Zusammenarbeit mit Magnus Hirschfeld so gut wie unerwähnt ließ. So hielt sie in Hinblick auf Hirschfeld lediglich fest: „So mannigfache Bedenken man gegen seine Persönlichkeit und gegen seinen Charakter haben mag, so bleibt doch das Verdienst in seinem Kampf gegen die Härten einer Gesetzgebung gegenüber den Homosexuellen unbestritten.“
Schriften (Auswahl)
Stöcker, Helene (1908): Das Recht über sich selbst [Besprechung zu Kurt Hiller: Das Recht über sich selbst]. In: Die neue Generation (Jg. 4), Nr. 7, S. 270-273.
Stöcker, Helene (1919): Die Revolution des Herzens. In: Kurt Hiller (Hg.): Das Ziel. Jahrbücher für geistige Politik (Das Ziel, 3). München: Kurt Wolff Verlag, S. 16-21.
Stöcker, Helene (1924): Erotik und Altruismus. Leipzig: E. Oldenburg.
Stöcker, Helene (1925): Liebe. Roman. Berlin: Verlag der Neuen Generation.
Stöcker, Helene (1929): Kameradschaftsehe und Sexualreform. In: Hertha Riese und J. H. Leunbach (Hrsg.): Sexual Reform Congress. W.L.S.R. World League for Sexual Reform. Proceedings of the Second Congress. Copenhagen, 1–5 July 1928. Kopenhagen, Leipzig: Levin & Munksgaard, Georg Thieme Verlag, S. 100-106.
Stöcker, Helene (2015): Lebenserinnerungen. Die unvollendete Autobiographie einer frauenbewegten Pazifistin (L’homme Archiv, 5). Hrsg. von Reinhold Lütgemeier-Davin, Kerstin Wolff, Stiftung Archiv der Deutschen Frauenbewegung, Kassel. Köln: Böhlau.
Weiterführende Literatur
Kokula, Ilse (1985): Helene Stöcker (1869–1943), der „Bund für Mutterschutz” und die Sexualreformbewegung, mit besonderer Berücksichtigung des Emanzipationskampfes homosexueller Frauen und Männer, in: Mitteilungen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft (6), S. 5-24.
Wickert, Christl (1991): Helene Stöcker 1869–1943. Frauenrechtlerin, Sexualreformerin und Pazifistin. Eine Biographie. Bonn: Dietz.
Wickert, Christl (2009): Helene Stöcker (1869–1943), in: Sigusch, Volkmar und Günter Grau (Hrsg.): Personenlexikon der Sexualforschung. Frankfurt/New York: Campus, S. 672-678.
Zeitleiste zum Lebensweg Helene Stöckers auf Lebendiges Museum Online.
Stolle, Hildegard (Konzertsängerin, Pianistin) geb. 12.4.1880 (Meerane, Sachsen) – gest. 9.6.1936 (Hagen, Westfalen)
Zur Biografie


Clara Hildegard Stolle wurde am 12. April 1880 als uneheliches Kind der ledigen Wirtschafterin Henriette Wilhelmine Wege im sächsischen Meerane geboren. Als ihre Mutter 1885 den geschiedenen Musikdirektor Carl Heinrich Stolle (1840–1911) heiratete und er die Vaterschaft von Hildegard und Frieda Stolle anerkannte, fiel auch ihr der Familienname Stolle zu. Carl Heinrich Stolle unterstützte die Sozialdemokratie und war Mitglied der Meeraner Stadtverordnetenversammlung. Von 1889 bis 1901 gehörte er auch der zweiten Kammer des sächsischen Landtags an.
Hildegard Stolle studierte in den 1890er Jahren bei dem Gesangspädagogen August Iffert (1859–1930) am Dresdner Konservatorium und ließ sich hier auch bei Emma Jungnickel zur Konzertpianistin ausbilden. Um 1902 gehörte sie dem Opernhaus in Heilbronn an, und am 5. Dezember 1903 bestritt sie einen Liederabend im Dresdner Trianon, an dem sie unter anderem Lieder von Beethoven, Brahms, Schumann und Richard Strauß aufführte.
1910 wurde Hildegard Stolle für das Koloraturfach an das Marionettentheater Münchener Künstler engagiert, und 1918 wechselte sie von Berlin aus als Hauptlehrerin für Gesang und Deklamation an das Konservatorium in Bielefeld, von wo sie jedoch schon im Folgejahr an das Bergische Konservatorium in Remscheid ging. Zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt unterrichtete sie auch Sologesang, Deklamation und Klavier am Konservatorium in Bromberg (heute Bydgoszcz, Polen). 1920 trat sie in Solingen und 1930 in Hagen auf. Hildegard Stolle verstarb am 9. Juni 1936 im Hagener Marienhospital. Da war sie nach wie vor unverheiratet.
Noch weniger als über Hildegard Stolle ist heute über ihre Schwester Friedel bekannt. Frieda Auguste Stolle wurde am 29. März 1883 ebenfalls unehelich in Meerane geboren und ließ sich zur Schauspielerin ausbilden. 1915 war sie als „Zweite Liebhaberin“ am Stadttheater in Aschaffenburg engagiert, und ab spätestens 1927 wohnte sie in Krefeld. Hier trat sie bis 1939 am Stadttheater auf, wurde dann aber aus unbekannten Gründen aus dem Ensemble verabschiedet. Nach dem Zweiten Weltkrieg engagierte sie sich ähnlich wie ihr Vater zuvor in der SPD. Friedel Stolle spielte 1947 erneut am Krefelder Stadttheater, bevor sie an die Landesbühnen Sachsen unter dem Intendanten Herbert Krauss wechselte. Offenbar blieb auch sie unverheiratet. Friedel Stolle starb am 12. August 1963 in Weimar.
Eine gemeinsame Schwester von Hildegard und Frieda Stolle war Else Gertrud Stolle (1888–1953), die 1914 den dänischen funktionalistischen Architekten Tyge William Mollerup (1888–1953) heiratete.
Weiterführende Literatur und Quellen
Anonym (1910): Theater und Konzerte, in: Salzburger Chronik für Stadt und Land (Nr. 108), 14.5.1910, S. 7.
Bach, Dr. (1939): Scheidenden Künstlern zum Abschied, in: Niederrheinische Volkszeitung, 30.6.1939 (Nr. 175), S. 2.
Derkowska-Kostkowska, Bogna (2013): Instytuty muzyczne i nauczyciele muzyki w Bydgoszczy od drugiej połowy XIX wieku do 1920 roku. In: Świadkowie kultury muzycznej na Pomorzy i Kujawach, hgg. von. Aleksandra Kłaput-Wiśniewska. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego.
Herzer, Manfred (2017): Magnus Hirschfeld und seine Zeit. Berlin/Boston: De Gruyter, S. 266.
Schüngeler, Heinz (1930): Hagener Musikleben, in: Kölnische Zeitung, 17.1.1930 (Nr. 13b), S. 2.
Sundquist, Alma (Ärztin, Sexualreformerin) geb. 23.3.1872 (Torp, Schweden) – gest. 7.1.1940 (Stockholm, Schweden)
Zur Biografie


Von 1901 bis 1939 betrieb Alma Sundquist eine private Praxis in Stockholm, war aber auch als Schulärztin und als Untersuchungsärztin von minderjährigen Industriearbeitern tätig und arbeitete von 1903 bis 1918 an einer Stockholmer Poliklinik. Sie blieb zeit ihres Lebens unverheiratet und spezialisierte sich im Zuge ihrer Berufstätigkeit auf den Gebieten Gynäkologie, Venerologie und Dermatologie.
Alma Sundquist war eine der engagiertesten Ärztinnen Schwedens ihrer Generation und hielt zahlreiche Vorträge zum Thema Sexualaufklärung. 1911 gehörte sie zu den Gründerinnen der schwedischen Vereinigung für Mutterschutz und Sexualreform. Sie setzte sich für die Stärkung der Berufsrechte von Ärztinnen ein, und 1919 nahm sie als schwedische Repräsentantin an dem New Yorker Konferenz teil, auf der die Internationale Vereinigung von Ärztinnen („Medical Women’s International Association“) gegründet wurde. Von 1934 bis 1937 war sie Sprecherin dieser Vereinigung.
Im Auftrag des Völkerbundes erarbeitete Alma Sundquist zusammen mit dem amerikanischen Juristen Bascomb Johnson und dem polnischen Diplomaten Karol Pinder von 1930 bis 1932 einen Bericht über den Sklavenhandel mit Frauen und Kindern im Orient und in Asien. Im Anschluss wurde sie in eine Reisekommission berufen, um die Erkenntnisse zu vertiefen. Alma Sundquist reiste von Japan aus über China, Indonesien, Indien und Persien nach Palästina, sprach hier mit verschiedenen Regierungsbeamten und sammelte weitere Informationen.
Auf ihrer Asienreise begegnete Alma Sundquist auch Magnus Hirschfeld. Hirschfeld hatte in Singapur aus der Zeitung erfahren, dass sich Sundquist zeitgleich mit ihm in der Stadt aufhielt, um einen ihrer „verdienstvollen Kampfvorträge gegen Prostitution und Mädchenhandel“ zu halten, wie Hirschfeld in seinem Bericht über seine Weltreise schrieb. Hirschfeld hielt fest: „Der Eindruck, den ich von ihr bei meinem Besuch in ihrem Hotel erhielt, war der einer sehr distinguierten, gütigen Dame, die erfüllt ist von ihrer hohen moralischen Mission.“ Welchen Eindruck Alma Sundquist von Magnus Hirschfeld gewann, ist nicht belegt.
Weiterführende Literatur
Hirschfeld, Magnus (1933): Die Weltreise eines Sexualforschers. Brugg: Bözberg-Verlag, S. 194-195.
Nilsson, Ulrika (2018): Alma M K Sundquist, in: Svenskt biografiskt lexikon.
Tobias, Recha (Schwester Magnus Hirschfelds) geb. 9.6.1857 (Kolberg, heute Kołobrzeg, PL) – gest. 18.9.1942 (Theresienstadt)
Zur Biografie


Sie heiratete um 1877 den Kaufmann Martin Tobias, der einer in Mecklenburg ansässigen jüdischen Familie entstammte. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor: Georg, Margarethe und Gustav, die zwischen 1878 und 1881 geboren wurden. Vermutlich lebte die Familie bis Anfang der 1880er Jahre im mecklenburgischen Teterow nördlich der Müritz, bevor sie nach Kolberg zog. 1882 war Martin Tobias der Erbauer der dortigen Solbadeanstalt. Später übernahm er das Solbad selbst, und nach seinem Tod wurde es von seiner Witwe weitergeführt. Sie lebte bis mindestens 1913 in Kolberg.
Ab etwa 1920 wohnte Recha Tobias in Berlin, und zwar zunächst in Schöneberg. Hier lebte auch ihr jüngster Sohn Gustav, der als Kaufmann tätig war. Einige wenige Jahre später zog sie in das Gebäude In den Zelten 9a in Tiergarten, das ihr Bruder Magnus Hirschfeld kurz zuvor erworben hatte. Es handelte sich um ein Nebengebäude zum Institut für Sexualwissenschaft. Möglicherweise war Recha Tobias aber schon weiter vorher in die Tätigkeiten im Institut für Sexualwissenschaft eingebunden. Bekannt ist ein Foto vom Besuch des preußischen Kultusministers Konrad Haenisch (1876–1925) vom 1. März 1920 im Institut, auf dem sie neben Magnus Hirschfeld sitzt.
Recha Tobias bewohnte hier den hinteren Trakt einer großen Wohnung, deren vordere Zimmer sie vermietete. Zwischen der Wohnung und dem Institutsgebäude gab es eine Verbindungstür, die Recha Tobias den direkten Zugang zu den Räumen ihres Bruders ermöglichte. So war sie im Institutsbetrieb durchaus präsent. Sie soll als Hirschfelds „Hausdame“, das heißt, als Leiterin des Haushalts, tätig gewesen sein. Recha Tobias war es auch, die den Institutsangestellten im Frühjahr 1932 die Nachricht überbrachte, ihr Bruder werde von seiner Weltreise nicht nach Berlin zurückkehren. Magnus Hirschfeld hatte ihr zuvor brieflich eine entsprechende Mitteilung zukommen lassen.
Zu den bekanntesten Untermietern von Recha Tobias gehörten die Schriftsteller Christopher Isherwood (1904–1986) und Walter Benjamin (1892–1940), der Philosoph Ernst Bloch (1885–1977) und der Archäologe Francis Turville-Petre. 1976 hielt Christopher Isherwood in seinem Erinnerungsbuch Christopher and His Kind (Christopher und die Seinen) über seine ehemalige, über 70-jährige Vermieterin fest: „Sie lebte irgendwo weitab im rückwärtigen Teil der Wohnung, auf einer Lichtung innerhalb eines Schwarzwalds von Möbelstücken. Falls ihr hin und wieder Beischlafgeräusche ans Ohr drangen, dann beschwerte sie sich nie. Vielleicht war sie im Prinzip sogar damit einverstanden – schließlich war sie ja Hirschfelds leibliche Schwester.“
Als das Institut für Sexualwissenschaft am 6. Mai 1933 geplündert und Teile der umfangreichen Bibliothek wenige Tage später auf dem Berliner Opernplatz verbrannt wurden, wurde auch Recha Tobias von den Ereignissen in Mitleidenschaft gezogen. Sie musste ihre Wohnung In den Zelten 9a Ende 1933 verlassen und zog zunächst nach Halensee, wo sie bis etwa 1938 wohnte. Danach siedelte sie zu ihrem ältesten Sohn Georg nach Biesdorf über, der ab 1907 als Augenarzt in Lichtenberg-Friedrichshain bzw. Karlshorst praktizierte. Von Biesdorf zog Recha Tobias schließlich in die Augsburger Straße 64 nach Schöneberg, wo sie zur Untermiete bei einer Lehrerin namens Margarethe Kallmann wohnte. Am 17. August 1942 wurde Recha Tobias von hier aus mit dem „1. großen Alterstransport“ nach Theresienstadt deportiert. Kaum sechs Wochen nach ihrer Ankunft in dem Lager kam sie am 28. September 1942 ums Leben. Sie war 85 Jahre alt. Als offizielle Todesursache wurde Herzschwäche angegeben.
Gedenken
Seit 2013 erinnert ein Stolperstein, der auf Initiative der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft verlegt wurde, vor dem Berliner Haus der Kulturen der Welt (John-Foster-Dulles-Allee 10) an Recha Tobias.
Weiterführende Literatur
Dose, Ralf (2004): Die Familie Hirschfeld aus Kolberg. In: Elke-Vera Kotowski und Julius H. Schoeps (Hrsg.): Magnus Hirschfeld. Ein Leben im Spannungsfeld von Wissenschaft, Politik und Gesellschaft (Sifria. Wissenschaftliche Bibliothek, 8). Berlin: be.bra wissenschaft, S. 33-64.
Dose, Ralf (2021): Haus-, medizinisches und Verwaltungspersonal des Instituts für Sexualwissenschaft. In: Mitteilungen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft, Heft 67, S. 9-32.
Wolfert, Raimund (2013): Recha Tobias née Hirschfeld, auf: Stolpersteine in Berlin.
Topf, Gertrud (Polizeigehilfin) geb. 1880/81 (Pillkallen, heute Dobrowolsk, Russland) – gest. 7.10.1918 (Berlin)
Zur Biografie
Die Polizeibeamtin Gertrud Topf wurde neben der Schriftstellerin Toni Schwabe 1910 als eine der ersten beiden Frauen in das Obmännerkollegium des Wissenschaftlich-humanitären Komitees (WhK) gewählt – auf „vielseitig, auch aus Frauenkreisen geäußerten Wunsche”, wie es in den Unterlagen der Organisation hieß. Das ungefähre Geburtsjahr Gertrud Topfs lässt sich bislang nur aus ihrer Sterbeurkunde ableiten. Im Übrigen ist über ihren Lebensweg – abgesehen davon, dass sie bei der Berliner Polizei tätig war – nur wenig bekannt.
Ende Januar 1905 unterzeichnete Gertrud Topf neben etlichen anderen, unter ihnen der Maler Hermann Struck, die Schriftsteller Hans Ostwald und Hermann Sudermann sowie der Direktor des Berliner Lessingtheaters Otto Brahm, einen Aufruf zur Rettung des russischen Schriftstellers Maxim Gorki (1868–1936), der seit seiner Kritik am harten Vorgehen der russischen Behörden gegenüber unbewaffneten Zivilisten am „Petersburger Blutsonntag” in Russland in Festungshaft einsaß.
Vermutlich war Gertrud Topf lesbisch. Als der Publizist und langjährige Mitarbeiter Hirschfelds im WhK Kurt Hiller Ende der 1940er Jahre die lesbische Journalistin Eva Siewert (1907–1994) kennenlernte und diese ihn brieflich nach Frauen aus dem Umfeld Hirschfelds fragte, nannte Hiller ihr gegenüber den Namen Topfs und den von Margarete Dost. Eva Siewert antwortete: „Die Damen Dost und Topf dürften schwer wiederzufinden sein. Schade, schade. Ich kannte sie nicht.“
Quellen
Aufruf „Rettet Gorki!”, in: Berliner Tageblatt und Handels-Zeitung, 30.1.1905, S. 1.
Boxhammer, Ingeborg und Christiane Leidinger (2020): Ereignisse im Kaiserreich rund um Homosexualität und „Neue Damengemeinschaft“ (hier: ND). LGBTI-Selbstorganisierung und Selbstverständnis, S. 8. Online hier.
Herzer, Manfred (2017): Magnus Hirschfeld und seine Zeit. Berlin: De Gruyter Oldenbourg, S. 102.
Trosse, Emma (Lehrerin, Autorin) geb. 6.1.1863 (Gransee) – gest. 23.7.1949 (Bad Neuenahr-Ahrweiler)
Zur Biografie


1900 heiratete Emma Trosse den Arzt Constantin Külz (1869–1923), und zwei Jahre später wurde sie Mutter einer Tochter. Da ihr als verheirateter Frau nach dem damaligen deutschen Recht das Unterrichten versagt war, baute sie zusammen mit ihrem Mann das erste Sanatorium für Menschen mit Diabetes in Neuenahr auf. Nach dem Tod ihres Mannes führte Emma Trosse die Geschäfte des Hauses weiter, bis sie es ihrer Tochter und deren Ehemann übergab.
Bereits neben ihrer Tätigkeit als Lehrerin und Schul- bzw. Pensionatsleiterin schrieb Emma Trosse Gedichte, die noch heute ihren Ruf als eine der beliebtesten Heimatdichterinnen des Ahrtals begründen. Sie setzte sich in wissenschaftlichen Abhandlungen aber auch mit mittelalterlichen medizinischen Schriften sowie insbesondere den Heilungsmöglichkeiten der Diabetes auseinander.
Darüber hinaus gilt Emma Trosse als eine Pionierin der emanzipatorischen Publizistik zur männlichen wie weiblichen Homosexualität. Ihre erste Schrift zum Thema, Der Konträrsexualismus inbezug auf Ehe und Frauenfrage, erschien bereits 1895 im Verlag von Max Spohr in Leipzig und damit noch vor entsprechenden Schriften Magnus Hirschfelds. Emma Trosses Buch Ein Weib? Psychologisch-biographische Studie über eine Konträrsexuelle wurde 1897 ebenfalls bei Spohr verlegt, allerdings anonym. Es ist heute die weltweit erste bekannte wissenschaftliche Abhandlung zur weiblichen Homosexualität, die von einer Frau verfasst und veröffentlicht wurde. Trosse legte diese Schrift vor, Jahre bevor sich Johanna Elberskirchen und Theo Anna Sprüngli öffentlich zur lesbischen Liebe bekannten.
Für Emma Trosse war die „Konträrsexualität“ eine angeborene Veranlagung, damit natürlich und historisch schon immer existent. Der Staat müsse Maßnahmen ergreifen, um das Recht der Menschen auf sexuelle Freiheit zu schützen. Trosse sprach sich für die Entpathologisierung der männlichen wie weiblichen Homosexualität aus und wandte sich strikt gegen die Kriminalisierung homosexueller Männer nach dem Paragrafen 175 RStGB. Innovativ waren auch Emma Trosses Überlegungen zu Menschen „ohne Sinnlichkeit“, also Personen ohne sexuelle oder erotische Interessen. Trosse zählte sich selbst zu diesen Menschen.
Emma Trosse veröffentlichte nicht nur auf Deutsch, sondern unter anderem auch auf Englisch und auf Polnisch. Einzelne ihrer Schriften wurden in Ländern wie dem Deutschen Reich, Österreich-Ungarn und Russland als „unmoralisch“ verboten.
Über die letzten Lebensjahre Emma Trosses ist nur wenig bekannt. Emma Trosse verlor im Alter ihr Augenlicht und starb am 23. Juli 1949, 86jährig und völlig erblindet, in Bad Neuenahr-Ahrweiler.
Schriften (Auswahl)
[Trosse, Emma] (1895): Der Konträrsexualismus inbezug auf Ehe und Frauenfrage. Leipzig: Max Spohr.
[Trosse, Emma] (1897): Ein Weib? Psychologisch-biographische Studie über eine Konträrsexuelle. Leipzig: Max Spohr.
[Trosse, Emma] (1899): Ist „freie Liebe“ Sittenlosigkeit? Leipzig: Max Spohr.
Weiterführende Literatur
Leidinger, Christiane (2011): Emma Trosse (1893–1949), verheiratete Külz – Lehrerin, Leiterin, Autorin. In: Mitteilungen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft Nr. 48, S. 17-21.
Leidinger, Christiane (2012): Transgressionen – Streifzüge durch Leben und Werk von Emma Trosse (1863–1949). Erste Denkerin des Dritten Geschlechts der Homosexuellen und Sinnlichkeitslosen. In: Invertito – Jahrbuch für die Geschichte der Homosexualitäten 14, S. 9-38.
Poppelreuter, Helmut (1987): Eine Heimatdichterin des Ahrtals: Emma Trosse (1863–1949). In: Heimatjahrbuch 1987, Kreis Ahrweiler, S. 66-69.
Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen. Hrsg. (2015): Persönlichkeiten in Berlin 1825–2006. Erinnerungen an Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen. Berlin, S. 74-75.
Wolkowa, Lida (Dr. med., Choreographin) geb. 22.7.1897 (Sofia, Bulgarien) – gest. 1943 (Ort nicht belegt)
Zur Biografie
Über Lida (auch Lidia bzw. Lydia) Wolkowa ist heute nur wenig bekannt. Belegt ist, dass sie am 22. Juli 1897 als Tochter eines Professors in Sofia (Bulgarien) geboren wurde. Als Namen ihres Vaters gab sie in ihrer Dissertation „A. Wolkoff” an, über ihre Mutter teilte sie hier nichts mit. Nach dem Besuch des Mädchengymnasiums studierte Lida Wolkowa zunächst ein Jahr Philosophie in ihrer Heimatstadt. 1916 ging sie in die Schweiz und von dort aus nach Deutschland, um Medizin zu studieren. Sie besuchte die Universitäten in Bern, Würzburg, Frankfurt am Main und Berlin.
Ihr Physikum legte Lida Wolkowa in Würzburg ab. Anschließend beschäftigte sie sich mit Psychiatrie und legte 1923 an der Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin ihre Dissertation unter dem Titel „Beitrag zum Zusammenhang zwischen schizophrenem Erleben und spiritistischem Weltbild” vor. Wohl im Rahmen der Arbeit an dieser Dissertation wandte sich Lida Wolkowa an das Institut für Sexualwissenschaft, und um diese Zeit wurde sie vorübergehend Mitarbeiterin Arthur Kronfelds, dem sie in ihrer Dissertation explizit für die Überlassung des behandelten Falles, weitere Materialien und Anregungen dankte.
Es scheint, nach ihrer Promotion hat sich Lida Wolkowa weniger mit medizinischen und psychiatrischen Fragen beschäftigt, sondern sich vielmehr als Choreographin, Ballettmeisterin und Solotänzerin einen Namen gemacht. Sie wurde zunächst am Nationalheater in Mannheim tätig und wechselte 1926 von dort an das Ostpreußische Landestheater in Königsberg (heute Kaliningrad, Russland), um anschließend an das Theater der Stadt Münster zu gehen. Sie galt als Choreographin als der deutschen Moderne verpflichtet.
Um 1932 muss Lida Wolkowa Deutschland verlassen haben. Zwei Jahre später war sie an der bulgarischen Staatsoper in Sofia angestellt und vertrat an der dortigen Musikakademie das Fach für Bewegungskunst. Anfang bzw. Mitte der 1930er Jahre hat Lida Wolkowa auch einen serbischen Arzt namens Besevic geheiratet. Denn in der bulgarischen Tagespresse wurde sie oft als Lidia Wolkowa-Besevic erwähnt, während sie in der deutschsprachigen Presse von Ende der 1920er Jahre in der Regel als „Fräulein” tituliert wurde. Lida Wolkowa-Besevic starb 1943, der genaue Zeitpunkt und Ort ihres Todes hat sich aber noch nicht ermitteln lassen.
Weiterführende Literatur
Anonym (1934): Münsterländischer Organist dirigiert an der bulgarischen Staatsoper, in: Stadtanzeiger für Castrop-Rauxel und Umgebung, 3.9.1934, [S. 10].
Kuhn, Ernst. Hrsg. (1992): Alexander Borodin. Sein Leben, seine Musik, seine Schriften (Musik konkret, 2). Berlin: Ernst Kuhn, S. 423.
Popov, Teodor (2000): Otnovo za nemskija svoboden izrazen tanc [Nochmals über den deutschen freien Ausdruckstanz; bulgarisch]. Sofia: RIK-I-S, S. 15.
Wolkowa, [Lida] (1923): Beitrag zum Zusammenhang zwischen schizophrenem Erleben und spiritistischem Weltbild. Berlin, Med. Diss. vom 14. August 1923.
Ein Auszug aus der Dissertation Lida Wolkowas erschien im Jahrbuch der Dissertationen der Medizinischen Fakultät Berlin, 1925, S. 224-227.
Beteiligte Mitarbeiter_innen
Weiterführende Literatur (Auswahl)
Beuys, Barbara (2015): Die neuen Frauen. Revolution im Kaiserreich: 1900–1914. München: Insel Verlag.
Boxhammer, Ingeborg und Christiane Leidinger (2020): Ereignisse im Kaiserreich rund um Homosexualität und „Neue Damengemeinschaft“ (hier: ND). LGBTI-Selbstorganisierung und Selbstverständnis. Available from: Online-Projekt Lesbengeschichte. Boxhammer, Ingeborg/Leidinger, Christiane, Zeittafel online hier.
Briatte, Anne-Laure (2020): Bevormundete Staatsbürgerinnen. Die „radikale” Frauenbewegung im Deutschen Kaiserreich (Geschichte und Geschlechter, 72). Frankfurt/Main: Campus.
Dobler, Jens. Hrsg. (2004): Prolegomena zu Magnus Hirschfelds Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen (1899–1923). Register – Editionsgeschichte – Inhaltsbeschreibungen (Schriftenreihe der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft, 11). Hamburg: von Bockel.
Dose, Ralf (2004): Die Familie Hirschfeld aus Kolberg. In: Elke-Vera Kotowski und Julius H. Schoeps (Hrsg.): Magnus Hirschfeld. Ein Leben im Spannungsfeld von Wissenschaft, Politik und Gesellschaft (Sifria. Wissenschaftliche Bibliothek, 8). Berlin: be.bra wissenschaft, S. 33-64.
Dose, Ralf (2014): Was bleibt, muss uns doch reichen? Von der Suche nach einem kulturellen Erbe. In: Elke-Vera Kotowski (Hrsg.): Das Kulturerbe deutschsprachiger Juden. Eine Spurensuche in den Ursprungs-, Transit und Emigrationsländern (Europäisch-jüdische Studien – Beiträge, 9). Berlin, München, Boston: Walter de Gruyter, S. 534-559.
Everard, Myriam (1986): Vier Feministinnen und das niederländische Wissenschaftlich-humanitäre Komitee oder: Wie die „Uranier” von der Frauenbewegung beurteilt werden. Übersetzung aus dem Niederländischen: Sabine Rieger. In: Mitteilungen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft, Heft 8, S. 21-37.
Grossmann, Atina (2004): Magnus Hirschfeld, Sexualreform und die Neue Frau. Das Institut für Sexualwissenschaft und das Weimarer Berlin. In: Elke-Vera Kotowski und Julius H. Schoeps (Hrsg.): Magnus Hirschfeld. Ein Leben im Spannungsfeld von Wissenschaft, Politik und Gesellschaft (Sifria. Wissenschaftliche Bibliothek, 8). Berlin: be.bra wissenschaft, S. 201-216.
Guddat, Sarah (2011): Geschlechterbilder im Wandel? Das Werk deutschsprachiger Schriftstellerinnen 1894–1945. Frankfurt/Main (u.a.): Lang.
Heinrich, Elisa (2022): Intim und respektabel. Homosexualität und Freundinnenschaft in der deutschen Frauenbewegung um 1900 (Sexualities in History – Sexualitäten in der Geschichte, 1). Göttingen: V & R unipress Open access (PDF) hier.
Kokula, Ilse (1986): Der linke Flügel der Frauenbewegung als Plattform des Befreiungskampfes homosexueller Männer und Frauen. In: Jutta Dalhoff, Uschi Frey und Ingrid Schöll (Hrsg.): Frauenmacht in der Geschichte. Düsseldorf: Schwann, S. 46-64.
Linnemann, Dorothee. Hrsg. (2019): Damenwahl! 100 Jahre Frauenwahlrecht. Begleitbuch zur gleichnamigen Ausstellung im Historischen Museum Frankfurt. Frankfurt/Main: Societäts-Verlag.
Marhoefer, Laurie (2022): Racism and the Making of Gay Rights. A Sexologist, His Student, and the Empire of Queer Love. Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press, hier u.a. S. 146-152.
Nave-Herz, Rosemarie (1997): Die Geschichte der Frauenbewegung in Deutschland. Hannover: Niedersächsische Landeszentrale für politische Bildung. Online hier.
Reinert, Kirsten (2000): Frauen und Sexualreform 1897–1933 (Forum Frauengeschichte, 22). Herbolzheim: Centaurus.
Sillge, Ursula (1989): Magnus Hirschfeld und die Frauen. In: Mitteilungen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft, Heft 13, S. 25-26.
Verein Feministische Wissenschaft Schweiz. Hrsg. (1988): Ebenso neu als kühn. 120 Jahre Frauenstudium an der Universität Zürich. Zürich: Etef.
Zeitstrahl Lesbische Geschichte Berlins 1900–1950 von Spinnboden Lesbenarchiv und Bibliothek e.V.
